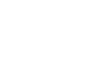Wobei man im Internet schon Texte findet…
Beiträge von Ouimet
-
-
 Pleiten statt Gemütlichkeit in der Karibik oder MünchenDie ZSC Lions sind harmlos und haben viermal in Serie verloren. Und der SC Bern ist derweil zur Schiessbude geworden.www.blick.ch
Pleiten statt Gemütlichkeit in der Karibik oder MünchenDie ZSC Lions sind harmlos und haben viermal in Serie verloren. Und der SC Bern ist derweil zur Schiessbude geworden.www.blick.chSo sieht die Bilanz des Stanley-Cup-Siegers von 1996 (Colorado) und Schweizer Meisters von 2014 (ZSC) nach sechs Spielen nicht gut aus. Nur ein Punkt pro Spiel hat Crawford geholt. Schlechter sind nur der bei Ajoie gefeuerte Filip Pesan und Zugs-Assistenzcoach Josh Holden, der für zwei Spiele der Chef war, als sich Dan Tangnes einer Rückenoperation unterziehen musste.
-
CC ist schon eine Legende - aber solche Typen gibt es ihm Profisport bald nicht mehr…
Aus der NZZ a/S
Er hat keine Lust mehr, Rechnungen zu zahlen
Christian Constantin steckte nahezu 100 Millionen Franken in den FC Sion. Nun kündigt er an, der Klub werde sich 2024 vom Spitzenfussball verabschieden. Von Nicola Berger, MartignyTräume?», fragt Christian Constantin, «natürlich habe ich noch Träume.» Constantin, 66, sitzt am Donnerstagnachmittag in seinem Büro, die Füsse mit den Dior-Schuhen hat er auf den Tisch gelegt. Er sagt: «Es gibt zwei Schweizer, die den Cup achtmal gewonnen haben. Karl Rappan und Severino Minelli. Wenn ich einmal in ‹Le Matin› lesen könnte, dass ich der Dritte bin, dann wäre ich glücklich.» Ein bisschen läuft dem Präsidenten des FC Sion dafür die Zeit davon, ihm bleiben noch zwei Chancen. Er, diese fast museale Kunstfigur, wird als eigenwilligster Fussballfunktionär in der Neuzeit des Schweizer Fussballs schon bald Geschichte sein. Und mit ihm der traditionsreiche Walliser Klub FC Sion in der Beletage.
Der Verkauf hat schon begonnen
In den vergangenen Tagen hat Constantin ein altes Versprechen ins kollektive Gedächtnis zurückgetragen: dass der von ihm seit Jahren alimentierte FC Sion in seiner gegenwärtigen Form nur noch bis zum Sommer 2024 existieren wird. Der Nutzungsvertrag über das Tourbillon-Stadion ist auf dann gekündigt, mit der Veräusserung der über etliche Dörfer verteilten Trainingsplätze hat Constantin bereits begonnen.«In Saxon ist es ein Kasino geworden, aus einem anderen wird eine Ikea, aus einem Dritten ein McDonald’s», sagt Constantin. Es geht jetzt alles schnell, ein Fussballimperium zerfällt. Constantin hat seinen Rückzug schon lange angekündigt, aber nicht viele haben ihm geglaubt. Weil alle dachten, dass er ohne den FC Sion nicht sein kann, diese Traumfabrik, dieses Lebenselixier.
Aber er sagt: «2024 ist Schluss in der Super League, dieser Entscheid ist endgültig. Dann wird Sitten in der Promotion League spielen. Mit einem Kader aus jungen Wallisern. Der Klub wird immer noch mir gehören, aber ich glaube nicht, dass ich noch Präsident sein werde.» Es hat eine tragische Ironie, dass es ausgerechnet Constantin, der es mit seinem Architekturbüro und seinen Immobiliengeschäften zu atemberaubendem Reichtum gebracht hat, in mehr als zwei Jahrzehnten nicht schaffte, ein neues Stadion zu bauen. Und der FC Sion noch immer in der 1968 erbauten Trutzburg Tourbillon beheimatet ist. «Ja, in dieser Hinsicht bin ich gescheitert. Aber ich hatte leider überall Opposition», sagt der Sion-Präsident.
Einen Verkauf seiner Aktien hält er für unrealistisch, er sagt: «Jedem seriösen Interessenten ist klar, dass man mit dem FC Sion kein Geld verdienen kann. Unsere Sauerkraut-Gala wirft pro Jahr 1,5 Millionen Franken Gewinn ab. Dafür mache ich auf der Bühne den Clown. Welcher Investor will denn schon den Clown spielen?» In seinen anderen Unternehmen will er bis 77 weiterarbeiten. «Wie Tintin», sagt er. Weil auf den «Tim und Struppi»-Bänden immer stand, sie seien für ein junges Publikum von 7 bis 77. Constantins Lachen hat etwas Schelmisch-Vergnügtes, so sehr freut ihn die Pointe. Aber wieso macht er das, wo er seine Vermögensbildung doch längst abgeschlossen hat? «Ich will nicht vor Langeweile sterben.»
Was das Adieu im Fussball angeht, hat ihn ein kurz vor Weihnachten gefälltes Bundesgerichtsurteil in seinem Beschluss bekräftigt, so formuliert er es. 2018 überwies seine Immobilienfirma 3,7 Millionen Franken an die Olympique des Alpes SA, in deren Besitz sich die Aktien des FC Sion befinden. Ersteres Unternehmen wies das als Sponsorenbeitrag aus und machte Steuerabzüge geltend. Gegen diese Praxis klagte der Kanton Freiburg, der ebenfalls Anrecht auf einen Teil der zu entrichtenden Steuern hat – und erhielt nun vor Bundesgericht recht, das urteilte, es handle sich nicht um ein Sponsoring, sondern um eine «verdeckte Gewinnausschüttung», heisst es in der Begründung. Constantin wird eine Nachzahlung in noch nicht festgelegter Höhe leisten müssen. Falsch sei das, sagt der Unterlegene, das Urteil verunmögliche es, Investitionen in den Klub vorzunehmen.
Was aber eigentlich einerlei ist. Denn Constantin ist ohnehin nicht mehr gewillt, das strukturelle Defizit des FC Sion zu decken. Er fährt aus seinem Sessel hoch, wühlt in Papieren und präsentiert dann eine Excel-Tabelle, an deren Ende eine Zahl steht: 92,688 Millionen Franken. So viel, behauptet Constantin, habe er in all den Jahren – seine zweite Amtszeit begann 2003 – in den Klub gesteckt. Doch jetzt sagt er: «Es gibt den Patron alter Schule nicht mehr, den Präsidenten, der die Rechnungen bezahlt. Sie sind ausgestorben wie die Dinosaurier.»
Gilbert Facchinetti in Neuenburg, Paul-Annik Weiller bei Servette, Sven Hotz in Zürich – alles Vergangenheit. «Ich bin der Letzte», sagt Constantin. «Wenn du willst, dann hat mein Modell funktioniert, als YB noch im alten Wankdorf gespielt hat und Basel im Joggeli. Heute können solche Klubs mit ihren modernen Arenen ganz andere Summen generieren als wir. Es war eine andere Epoche, die geht jetzt zu Ende.»
Er klingt nicht verbittert, nicht traurig, eher wie ein Mann, der ein Kapitel abschliesst, einen Lebensabschnitt. Und der realisiert hat, dass es fast aussichtslos ist, im modernen Fussball die herrschende Klasse herauszufordern. Schon gar nicht auf Dauer, um Meister zu werden; der letzte Meistertitel liegt 25 Jahre zurück, in den Top 3 stand Sitten seit 15 Jahren nicht mehr. Und im Cup datiert der letzte Finaleinzug von 2017. Der Cup, dieser Wettbewerb, aus dem sie im Wallis seit Jahrzehnten so viel Kraft ziehen, davon träumt Constantin jetzt noch einmal, es soll sein Schlussbouquet werden.
Er hat einen neuen Coach angestellt, Fabio Celestini. Und wenn man fragt, ob er ihn auch deswegen verpflichtet habe, weil Celestini 2021 mit Luzern Cup-Sieger geworden ist, schüttelt er den Kopf und sagt: «Fabio und ich, wir haben uns schon vor langer Zeit versprochen, dass wir einmal zusammenarbeiten werden, wenn sich die Chance bietet.» Wieder fährt der Sion-Präsident aus dem Stuhl hoch und sucht ein leeres Blatt Papier, hinter ihm steht ein gerahmtes Bild, das ihn mit Gérard Depardieu zeigt, dem französischen Schauspieler, den das Licht ein bisschen verlassen hat, der 2019 aber an der Klubgala im Wallis auftrat. Dann zeichnet er Celestinis Signatur nach und sagt: «Er hat auf einem leeren Blatt unterschrieben und mir gesagt, ich solle, was seinen Lohn angeht, einfach jenen Betrag einfügen, den ich für richtig halte. Das habe ich getan, jetzt ist er hier.»
Celestini, 47, hat in Sitten auch den Auftrag, Constantins spektakulärsten Einkauf in Szene zu setzen: Mario Balotelli, der frühere italienische Nationalspieler mit der schillernden Vita. Balotelli, 32, Ende August 2022 verpflichtet und der teuerste Super-League-Profi der Geschichte, hat in neun Spielen immerhin fünf Tore erzielt, aber er stand unter dem entlassenen Coach Paolo Tramezzani nicht immer in der Startformation.
Hoffen auf den Balotelli-Moment
Balotelli ist einer von Constantins Prestigetransfers, die er, der dem italienischen Fussball so hingebungsvoll zugewandt ist, sich immer wieder geleistet hat: Er engagierte Gennaro Gattuso als Spieler und Trainer, später fand der Weltmeister Fabio Grosso den Weg ins Wallis. Balotelli, sagt Constantin, sei sein letzter grosser Transfer. Und ergänzt: «Dieser achte Cup-Sieg . . . Ich habe Mario auch deswegen geholt. Er ist ein spezieller Spieler für die grossen Momente.»
Die speziellen Spieler, die grossen Momente: Werden sie ihm nicht fehlen, wenn Sitten 2024/25 gegen Bavois, Baden und Breitenrain spielt? Constantin rückt seine Brille zurecht und sagt: «Hör zu, ich habe im Fussball alles erlebt. Wir haben das Double gewonnen, siebenmal den Cup, es gab wunderbare Europacup-Nächte. Ich brauche die Super League nicht. Ich mag den Fussball, das muss kein Auswärtsspiel in Basel sein. Der Champagner kann mir gestohlen bleiben, ich fühle mich im ‹Savoy› in Zürich nicht wohler als in der ‹Écurie› im Val de Bagnes. Was den Fussball angeht, kann es für mich auch ein Juniorentraining in Saint-Maurice sein. Und wenn wir am Nachmittag gegen Bavois spielen, fahre ich am Abend nach Mailand ins San Siro zu Inter. Wo ist das Problem?»
Und doch: Wird er eine Träne vergiessen, wenn Sitten sich in gut einem Jahr aus der Super League verabschiedet? Wo man hindenke, entgegnet Constantin, natürlich nicht. Er habe noch nie des Fussballs wegen geweint, das sei eine absurde Vorstellung, denn man dürfe nicht vergessen: Es sei nur ein Spiel, das Leben gehe weiter.
-
Wenn ich sehe dass die Rechtsradikale Junge Tat dieses Wochenende analog Basel einen Riesenbanner über den Bahnhof Sankt Gallen spannen konnten ohne von der Polizei daran gehindert worden zu sein und im Frühling 21 eine illegale Covid Demo in Rapperswil stattgefunden hat mit tausenden Teilnehmer die man nicht stoppen wollte, aber man für eine Sportveranstaltung dutzende Polizisten aufbieten kann wirft das für mich schon auch ein schales Licht vom Rechtsstaat im Kanton Sankt Gallen.
-
Scheisse du. Vieles habe ich davon schon verdrängt und irgendwie wohl akzeptiert. Aber vieles davon ist halt tatsächlich auch wirklich nicht besser als früher...
Aber es sind Sachen, über die man sich früher als Z-Fan nicht lustig gemacht hat und hat sie jetzt selber und findet es noch lässig! Kommt dazu, dass was die Liga einführt (Goldhelm, Silberhelm, Topscorer, sinnlos lange Pause) etwas anderes ist, als Sachen, die die eigenen Fans einführen, weil es die anderen auch machen.Wir hatten auch mal Chearleader:Innen 🙄😜
-
Haha. Und dieser Videowürfel sind ja auch nicht etwas Neues. Nur beim Z ist es neu. Es hat sicher auch viele Leute, die noch nie ein Spiel
ohne den Würfel gesehen haben. Ist sicher auch unnötig ........
Ist denn immerhin das Megaphon genehm? Frage geht an alle welche noch Spiele ohne diese Sachen erlebt haben. Oder das Torwandschiessen?
Oder das ZSC Lions TV? Oder Instagram, oder Mobilephones? Nervt doch sicher auch, wenn das Spiel läuft und neben einem ist jemand der
Fotos macht und evtl. sogar Selfies, oder?
Diese Pre Game Show muss doch auch nicht sein oder? Oder dieses Lions? Topscorer Helm? Drittelspause von 18 Minuten? 14 Nati A Teams? Nur Bargeldlos im Stadion zahlen? Das Rauchverbot in der SLA? Überhaupt wieso SLA, hat man die Fans überhaupt gefragt ob sie die Namensrechte vom Stadion verkaufen wollen? Dazu die Leibchen von ehemaligen Spielern an die Hallendecke hängen, brauchte es früher ja auch nicht. Frage geht an alle welche noch Spiele vor 30 Jahren im alten Hallenstadion erlebt haben ohne Trommeln, Megaphon, Doppelhalter, Fahnen, pre Game Show, Rauchverbot, Lions, Handybezahlung, Topscorerhelm, 15 Minuten Drittelspausen, Spielerleibchen an der Hallendecke…
-
Als ob alles schlecht war mit RG…. Qualisieg, Finalteilnahme plus jeweils weiter gekommen in der CHL. Tabellarisch sind wir mit MC jedenfalls schlechter als vor dem Trainerwechsel, inkl Heimniederlage gegen den Aufsteiger. Aber noch bleibt ja Zeit bis zum Saisonbeginn. Aber auch da wird dann MC mit RG verglichen, sprich alles andere als eine Finalteilnahme ist eine Verschlechterung…
-
Aber das grösste Problem ist dass es keine Leader gibt!
Ist der Job von SL. Aber der geniesst hier ja Artenschutz…
Aktuell auch nicht mehr auf Platz 3 und somit nicht für die CHL qualifiziert.
-
Für alle Chaoten die Pyrros auf Polizisten schiessen (vielleicht auch Väter, auf jedenfall Menschen) knallhart 2 Jahre Knast und 10.000 Franken Busse.
Gibts auch auf der anderen Seite, Polizisten die einem friedlichen Fan blind schiessen… beides zu verurteilen…
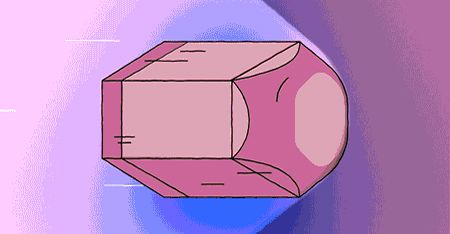 Voll ins AugeGummigeschosse führen zu schweren Verletzungen mit gravierenden Folgen. Trotzdem setzt die Schweizer Polizei auf das Einsatzmittel.www.republik.ch
Voll ins AugeGummigeschosse führen zu schweren Verletzungen mit gravierenden Folgen. Trotzdem setzt die Schweizer Polizei auf das Einsatzmittel.www.republik.ch -
Naja, auswärts wurde in den letzten 20 Jahren desöfteren gezündet ohne den medialen Aufschrei wie jetzt…
Das der SCRJ jetzt so ein Drama wegen etwas Rauch macht wundert mich nicht. Netzfund gemacht die Facebook Gruppe der Stadt Rapperswil mit 6000 Mitgliedern „City Rapperswil Jona“ schwurbelt auch sonst ganz laut und forderte ein Boykott von Mike Müller und ruft zu Corona Demos auf… von daher die berühmte Mücke und der Elefant…
-
Die Kantonspolizei Sankt Gallen hätten halt vom Stadion bis zum Bahnhof eine lange Polonaise aufführen sollen.
Corona-Demo in Rapperswil: Polizisten-Umarmung sorgt für ZwiespaltAn der Corona-Demo am Samstag umarmte eine Demonstrantin einen Polizisten. Während Anwohner die Reaktion des Beamten positiv bewerten, können Politiker diese…tv.telezueri.ch -
 Podcast zum Schweizer Eishockey – «Auch als Schiedsrichter musst du Ziele haben»Wie wird man Schiedsrichter? Warum wird man Schiedsrichter? Micha Hebeisen, Profi-Referee in der Schweizer Eishockeymeisterschaft, erzählt aus seinem…www.tagesanzeiger.ch
Podcast zum Schweizer Eishockey – «Auch als Schiedsrichter musst du Ziele haben»Wie wird man Schiedsrichter? Warum wird man Schiedsrichter? Micha Hebeisen, Profi-Referee in der Schweizer Eishockeymeisterschaft, erzählt aus seinem…www.tagesanzeiger.ch -
Es wird inzwischen auch davon Berichtet das mehrere "Fans" versucht hatten in die Garderoben der Rosetten einzudrignen. Falls das stimmt, wird es wohl noch ein grösseres Thema werden.
Wobei nüchterne Hockeyspieler gegen alkohlisierte Fans wohl nicht den kürzeren ziehen würden…
-
Wobei unser Hauptsponsor doch schöne Zinsen auf seinen Immobilien Anlagen verspricht….
Aus der NzZ:
Manche Spitzensportler verdienen enorme Summen. Trotzdem reicht es den wenigsten für eine «Frühpensionierung»
Finanziell aussorgen können in der Schweiz die wenigsten Spitzensportler und -sportlerinnen. Auch wenn bei Fussballern und Eishockeyspielern das Einkommen in jungen Jahren hoch ist, reicht es selten für eine «Frühpensionierung».
Cristiano Ronaldo soll nach seinem Transfer zum saudiarabischen Klub Al-Nassr FC 547 945 Franken verdienen – am Tag. Der bald 38-jährige Fussballstar wird bis 2025 ein Jahressalär von 200 Millionen Franken einstreichen und ist damit der bestbezahlte Fussballer der Geschichte.
Sein ewiger Konkurrent Lionel Messi, Captain und Star des neuen Fussballweltmeisters Argentinien, kassiert gemäss der Website Fussballtransfers 41 Millionen Euro für seine Dienste bei Paris St-Germain, dem Klub, der dem katarischen Geschäftsmann Nasser Al-Khelaifi gehört.
Zu den Weltklasse-Athleten, deren finanzielle Zukunft auch für die nächsten Jahrzehnte gesichert ist, zählen auch einige Schweizer. Neben Roger Federer und Stan Wawrinka und dem Basketballspieler Clint Capela (Jahresgehalt: rund 17 Millionen Franken) verdienen einige Eishockeyspieler, die in der National Hockey League in den USA spielen, und im Ausland engagierte Fussballer genügend, um später davon leben zu können; dazu einige Top-Skifahrer und -Skifahrerinnen wie Marco Odermatt und die Tennisspielerin Belinda Bencic. Doch dann wird die Luft bereits dünn.
Geringes Einkommen bei olympischen Sportarten
Gemäss der im Juni 2021 veröffentlichten Studie «Leistungssport Schweiz» des Bundesamtes für Sport kamen im Jahr 2018 nur 17 Prozent der befragten Schweizer Leistungssportlerinnen und Leistungssportler aus olympischen Disziplinen auf ein Gesamteinkommen von jährlich über 70 000 Franken. 41 Prozent der befragten Athletinnen und Athleten mussten mit einem Einkommen von weniger als 14 000 Franken auskommen. Dabei eingerechnet sind auch Einkommen aus einem allfälligen Nebenerwerb.
Auch Schweizer Fussball- und Eishockeyprofis backen deutlich kleinere Brötchen als die Topstars. Einkommen und Vermögen eines durchschnittlichen Schweizer Profis, der keine grosse Auslandkarriere anstrebt, könnten gemäss einem spezialisierten Finanzinstitut wie folgt aussehen: Sein Jahreseinkommen beträgt 300 000 Franken, und er verfügt über ein Vermögen von 750 000 Franken. Dazu wohnt er in einem Eigenheim.
Bei den in der Schweiz tätigen Fussballprofis gebe es bloss etwa dreissig Spieler, die so gut verdienten, dass sie einiges auf die Seite legen könnten, sagt Benjamin Huggel. Das Lohnniveau in der Super League ist in den letzten Jahren gesunken. «Die Einnahmeausfälle während der Covid-Pandemie haben sich auch in den Löhnen der Spieler niedergeschlagen», sagt Huggel.
Der ehemalige Fussballprofi des FC Basel und von Eintracht Frankfurt ist Mitbegründer von Athletes Network. Das Unternehmen bietet ein Netzwerk für Sportler, die während und nach der Karriere den Einstieg ins Berufsleben anstreben. Die siebzig Unternehmenspartner wie Migros-Industrie, Postfinance, Sunrise und Zurich offerieren Stellen, weil sie die Mentalität und die Denkweise von Athletinnen und Ex-Athleten als bereichernd empfinden.
«Was machsch du eigentlich jetzt?»
«Nach dem Karriereende durchlaufen viele Sportlerinnen und Sportler keine einfache Zeit», erklärt der ehemalige Nationalspieler Huggel. Von einem Tag auf den anderen steht man nicht mehr im Scheinwerferlicht. «Was machsch du eigentlich jetzt?» sei dann die meistgehörte Frage gewesen, die ihm damals gestellt worden sei, und das habe mit der Zeit genervt. «Aber auch, weil ich eine Zeitlang nicht so recht wusste, was ich machen will.»
Inzwischen ist Huggel (45) in der Nach-Fussball-Zeit angekommen. Im Frühjahr 2020 gründete er mit Severin Blindenbacher (Ex-Hockeyspieler), Niels Hintermann (Skifahrer) und Dave Heiniger Athletes Network, welches das Bewusstsein für den schwierigen Übergang von einer Spitzensport-Karriere in die Nach-Sport-Karriere schaffen will. Zuvor hatte er eine Ausbildung in Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Nordwestschweiz abgeschlossen. Zudem tritt er als Referent auf, ist SRF-Fussballexperte, Verwaltungsrat bei der Rennbahnklinik in Muttenz und caritativ tätig.
Zu wenig Lebenserfahrung
Mit Blick auf Finanzen sagt Huggel: «Die Finanzbildung in der Schweiz ist schlecht.» Denke er zurück an seine eigene Situation zu Beginn seiner Karriere, stelle er fest, dass man als junger Mensch zu wenig Lebenserfahrung habe, um abzuschätzen, welcher Kundenberater wirklich hilfreich sei. «Unter Spielerkollegen redet man wie sonst in der Schweiz auch nicht übers Geld.» Schliesslich habe er einen Teilhaber einer Vermögensverwaltungsfirma gefunden, der ihn beraten habe, allerdings ohne auf Sportler spezialisiert gewesen zu sein.
Remo Meister, Kommunikationschef des FC Basel, sagt dazu: «Wir beraten die Mitarbeitenden und Spieler und Spielerinnen gerne bei finanziellen Fragen, falls dies gewünscht wird. Falls es kompliziertere Anfragen gibt, vermittelt der FCB die Betroffenen auch gerne an Spezialisten aus seinem Partnernetzwerk weiter.»
Insgesamt hielten sich die Anfragen seitens der Spieler aber in Grenzen. Einige gingen mit allfälligen Fragen wohl auch direkt auf ihr privates Berater-Umfeld zu, andere kümmerten sich vielleicht auch nicht proaktiv um Vorsorgethemen und Finanzfragen.
AHV-Beiträge von Profis
Betreffend Vorsorge muss zwischen Mannschafts- und Einzelsportlern unterschieden werden. Bei Mannschaftssportlern sind die Arbeitgeber für die Pensionskasse zuständig, während die Vorsorgeberatung für Einzelsportler komplexer ausfallen kann.
Bei Vermarktungsrechten stellt sich die Frage, ob diese vom Sportler direkt oder über eine Zweckgesellschaft vereinnahmt werden. In jedem Fall empfiehlt sich eine individuelle Analyse der konkreten Situation, da die rechtlichen und steuerlichen Auswirkungen je nach Konstellation sehr unterschiedlich sein können.
Sämtliche erwerbstätigen Mannschaftssportler sind obligatorisch versichert (AHV/IV/BVG). Die Selbstvorsorge in der dritten Säule sei Privatsache, sagt Meister, so wie bei Angestellten anderer Unternehmen auch. Im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung sind die Mitarbeitenden bei Berufs- und Nichtberufsunfällen sowie bei Berufskrankheiten versichert, auch hier wie andere Arbeitnehmende. Nach Ablauf bestimmter Fristen werden gemäss Unfall- und Krankenversicherung maximal 80 Prozent des versicherten Lohnes weiter bezahlt. Dabei sind allerdings variable Lohndaten wie Prämien nicht versichert.
Früher Karrierehöhepunkt
Im Gegensatz zu Personen mit klassischen Berufen erleben Sportlerinnen und Sportler meist in jungen Jahren den Höhepunkt ihrer Karriere. Dementsprechend ist auch ihr Verdienst in jungen Jahren relativ hoch und nimmt mit der Zeit stark ab.
Steve Krähenbühl, UBS-Kundenberater Sports & Entrepreneurs, stellt denn auch fest, dass viele Sportler kurzfristig zwar relativ hohe Einkommen hätten. Trotzdem hätten viele in späteren Jahren Schwierigkeiten, ihren Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Grund dafür ist oftmals, dass sie ihr Geld nicht richtig angelegt haben.
Für Sportler müssen im Vergleich mit anderen Kunden zusätzliche Parameter in die Kalkulationen einbezogen werden. «Langfristiges, nachhaltiges Anlegen ihres Geldes ist für Individuen dieser Berufsgruppe besonders relevant, da bereits zu Beginn ihrer Karriere grosse Summen an Geld vorhanden sind, die es zukunftsorientiert anzulegen gilt», sagt der UBS-Kundenberater.
Geht man davon aus, dass ein Sportler mit 35 Jahren seine Karriere beendet, ein jährliches Budget von rund 200 000 Franken pro Jahr hat und seine Restlebenszeit rund 50 Jahre beträgt, muss er über ein Vermögen von mindestens 10 Millionen Franken verfügen, um davon leben zu können. Dabei werden die Dividendeneinnahmen für seine Steuern verwendet; in dieser einfachen Rechnung sind Zinseszinsen und Rendite-Erfolg nicht berücksichtigt.
In der Aktivzeit geschickten Anlagemix aufbauen
Da dies die meisten Sportler nicht erreichen, sind viele beim Karriereende damit konfrontiert, dass die verbleibenden Einnahmen ihre gewohnten Ausgaben nicht mehr decken. Daher könne es sinnvoll sein, durch einen geschickten Anlagemix während der aktiven Karriere Portfolios aufzubauen, die nach der sportlichen Karriere überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen ermöglichten, sagt Krähenbühl.
Ein Bankberater, der nicht genannt werden will, schätzt, dass das typische Portfolio eines gut verdienenden Fussballprofis aus 60 bis 80 Prozent Aktien, 20 Prozent Private Equity und 0 bis 20 Prozent Obligationen bestehe, «wobei nun Obligationen wiederum an Attraktivität gewinnen». Dazu besitzen viele Spieler ein Eigenheim. In der Regel haben solche Profis ein diskretionäres Mandat, die Bank übernimmt nach Festlegung des Anlage- und des Risikoprofils die Investment-Entscheide.
In Immobilien anlegen
Ein anderer Kundenberater, der vor allem südamerikanische Fussballprofis in der Schweiz betreute und dies teilweise heute noch tut, sagt, dass Spieler, die aus Ländern mit schwacher Wirtschaft und hoher Inflation stammten, oft Bedenken hätten, wie sicher die angelegten Gelder seien. «Sie möchten ihr Vermögen am liebsten in Cash halten», sagt der Berater. Er müsse ihnen aufzeigen, dass Bargeld bei Inflation durch die Geldentwertung ebenfalls an Wert verliere. Viele Spieler wollten auch in Immobilien investieren.
Bekannt ist, dass der Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin und auch die Nationalspieler Granit Xhaka, Breel Embolo und Djibril Sow in Liegenschaften investiert haben.
Nicht nur aus finanzieller Sicht ist für Spitzensportler der Übergang von einer Spitzensport-Karriere in die Nach-Sport-Karriere meistens extrem schwierig. Umso wichtiger ist es, dass sie realistische Vorstellungen haben, wie ihre finanzielle Situation aussieht. Für die meisten Profis in der Schweiz beginnt mit dem Ende der Sportkarriere ein Neustart auch im beruflichen Leben.
Gemäss Huggel von Athletes Network haben seine Kunden fast alle eine abgeschlossene Berufslehre oder die Matura. «Doch starten danach noch zu wenige weitere Ausbildungen während der Fussballkarriere. Das ist beispielsweise im Herren-Eishockey in der Schweiz viel besser.»
-
Aber im Ernst … Aufwand vs. Kosten vs. Nutzen komplett sinnbefreit.
In Sankt Gallen musste man sich beim Auswärtssektor jeweils bis auf die Unterwäsche ausziehen. Trotzdem wurden Pyros reingeschmuggelt. Man findet immer einen Weg.
-
Ich fand es richtig Noreau keinen neuen Vertrag zu geben. Das er jetzt bei Rappi nochmals seinen zweiten Frühling erlebt, schön für ihn. Cervenka war bei uns dauerverletzt und unklar ob er je wieder voll Hockey spielen kann. Rappi hat das Risiko genommen.. wir nicht. Im Nachgang ist man immer schlauer.
Womit wir wieder bei SL wären… gäbe wohl günstigere und bessere Sportchefs…
-
Noch sucht Marc Crawford – und verströmt doch Zuversicht
Nach der Niederlage gegen Ajoie waren die Zürcher gegen die Lakers chancenlos. Immerhin: Der neue Coach weiss nun, was nicht funktioniert.
Marc Crawford hätte sich aus seinen ersten vier Spielen mit den ZSC Lions bestimmt vier Siege und zwölf Punkte gewünscht. Doch der Kanadier sieht seine erste turbulente Woche hinter der Zürcher Bande trotzdem positiv, weil als wertvolle Erfahrung. Er sagt: «Ich glaube, ich habe ein ziemlich repräsentatives Bild vom Team erhalten.»
Auf die schmeichelhaften Siege gegen Biel (2:1) und Bern (3:0) folgten die Rückschlage gegen Ajoie (2:3) und die Lakers (2:5). «Beide Niederlagen sind nachvollziehbar», sagt Crawford. «Das Ajoie-Spiel gewinnen wir in der Regel aufgrund der Chancen. Aber Ajoie spielte clever, wartete und nutzte seine Möglichkeiten. Gegen die Lakers war das erste Drittel gut, danach sahen wir aus wie ein Team, das auf Reserve fuhr. Wir liessen den nötigen Fokus vermissen, was passieren kann, wenn man müde ist. Es war unser viertes Spiel in sieben Tagen.»
«Ich spüre einen grossen Willen der Spieler, sich zu verbessern. Das stimmt mich sehr zuversichtlich.»
Marc CrawfordDer Kanadier betont aber auch sogleich, bisher viel Positives gesehen zu haben. «Ich habe eine Gruppe angetroffen, die mit grossem Engagement ans Werk geht. Ich spüre einen grossen Willen der Spieler, sich zu verbessern. Sie sind überhaupt nicht zufrieden. Wir haben gute Leader, der Charakter des Teams stimmt. Das ist eine gute Ausgangslage und stimmt mich sehr zuversichtlich.»
Die grösste Baustelle ist leicht ausgemacht: Es fehlen die Tore. Viermal brachten die Zürcher nur je zwei Treffer zustande, dazu noch das 3:0 gegen den SC Bern ins verlassene Gehäuse. «Wir müssen mehr Offensive produzieren, ganz klar», sagt Crawford. «Es reicht nicht, wenn wir meinen, wir könnten unsere Gegner allein mit unserem Skills ausspielen. Wir müssen viel mehr Intensität entwickeln, viel mehr schiessen, den Preis in der Offensive bezahlen. Wir müssen gute Gewohnheiten entwickeln, dann kommen auch die Resultate.»
Wenn die Zürcher freies Eis vorfanden, kamen sie zu Chancen. Aber es gelang ihnen zu selten, Druck auf die Verteidiger und aufs Tor zu machen. Da will Crawford ansetzen. Das Team befindet sich in einem Transformationsprozess, bewegt sich momentan noch zwischen den Gewohnheiten unter Rikard Grönborg und den Ideen von Crawford. Es ist noch anfällig auf Rückschläge, wie man besonders am Samstag am Obersee sah, als die Lakers, angeführt von Roman Cervenka, die Kadenz erhöhten. Was Crawford unbedingt abstellen will: die zahlreichen Stockfouls. Am Freitag und Samstag kassierten die ZSC Lions in der Summe vier Tore in Unterzahl.
Bisher keine Entdeckung
Bei jedem Trainerwechsel werden die Karten neu gemischt. Die Spieler haben die Gelegenheit, sich neu zu präsentieren. Crawford gab beispielsweise Sopa und Bachofner die Möglichkeit, sich in einer Offensivlinie zu zeigen. Sopa stürmte zusammen mit Lammikko und Texier, Bachofner neben Roe und Riedi. Doch beide brachten nichts Zählbares zustande. Und Verteidiger Guebey lenkte gegen Ajoie den Puck zum 0:1 ins eigene Tor ab. Eine grosse Entdeckung gab es für Crawford bisher noch nicht.
Roe traf am Obersee immerhin erstmals seit dem 21. Oktober wieder. Der 34-jährige Amerikaner kämpft verzweifelt um die Fortsetzung seiner Karriere in der Schweiz. Mit einem Bandencheck erwies der eifrige Stürmer seinem Team aber gegen die Lakers einen Bärendienst. Zu gefallen wusste der 20-jährige Stürmer Marlon Graf am Samstag bei seinem National-League-Debüt. Aber wenn Azevedo und Andrighetto zurückkehren, wird es für die Jüngeren wieder schwieriger, gutes Eis zu erhalten.
Klar ist: Ein Trainerwechsel während der Saison ist immer auch mit Risiken und Nebenwirkungen verbunden. Das letzte Mal, als Arno Del Curto im Januar 2019 übernahm, ging es schief. Und auch unter Hans Kossmann, der das Team 2018 als Nothelfer zum Titel führte, lief es lange nicht wie gewünscht. Von den ersten neun Spielen unter dem Kanadaschweizer verloren die Zürcher deren sechs. Erst zum Playoff-Start gegen Zug machte es so richtig klick.
Noch zwei Monate
Crawford hat noch zwei Monate Zeit, bis das Playoff beginnt. Er gibt sich zuversichtlich, dass die ZSC Lions bis da ihre neue Identität gefunden haben. Diese und nächste Woche hat er jeweils vier Tage Zeit, um im Training an einigen Dingen zu feilen, dann folgt für die Zürcher bis Ende Januar eine intensive Phase mit sieben Spielen in zwölf Tagen.
Crawford ist überzeugt, dass er das Schweizer Eishockey jetzt deutlich besser versteht als 2012, als er erstmals nach Zürich kam. Damals habe er eine Saison gebraucht, um die wahren Stärken gewisser Spieler zu erkennen. Der 61-Jährige ist inzwischen vom Hotel in Altstetten in seine Wohnung in Winkel umgezogen. Bald soll auch seine Frau nachkommen.
-
Das nächste Mal könnte man eventuell die Farbwahl der Fackeln überlegen… Rappi hat ja immer alli in rot im Stadion und dann zündet der Auswärtssektor rote Fackeln…. Gibt auch Rauchtöpfe in Blau 🥳😝
-
Noreau und Cervenka trumpfen bei Rappi gross auf… nachdem sie bei uns Mittelmass waren…
-
 Arbeitstage von bis zu 16 Stunden – Sie machen viel mehr als nur müde Muskeln knetenDie Masseure und Physiotherapeutinnen werden auf der Eishockey-Bank oft übersehen. Dabei sind sie neben dem Eis unverzichtbar.www.tagesanzeiger.ch
Arbeitstage von bis zu 16 Stunden – Sie machen viel mehr als nur müde Muskeln knetenDie Masseure und Physiotherapeutinnen werden auf der Eishockey-Bank oft übersehen. Dabei sind sie neben dem Eis unverzichtbar.www.tagesanzeiger.chSie machen viel mehr als nur müde Muskeln kneten
Die Masseure und Physiotherapeutinnen werden auf der Eishockey-Bank oft übersehen. Dabei sind sie neben dem Eis unverzichtbar.
Sie leuchten in ihren gelben Kleidern und doch nimmt sie niemand wahr. Wer als Zuschauerin oder Zuschauer einen Eishockeymatch verfolgt, sieht sie nur, wenn ein Spieler sich verletzt hat und gestützt vom Eis geführt werden muss: die Masseurinnen und Physiotherapeuten.
Ohne ihre Arbeit würde in den National-League-Clubs wohl wenig zustande kommen. Und doch müssen sie sich oft Fragen anhören wie: «Was machst du sonst noch?» oder «Kann man davon leben?»
Auch die Berufsbezeichnung wird ihnen nicht gerecht. «Massagen sind ein Teil, ein sehr kleiner Teil vom Tag», sagt Andreas Badertscher. Seit elf Jahren ist er bei den ZSC Lions als Masseur angestellt. Dabei ist er viel mehr als das. «Ich bin medizinischer Betreuer, ich bin eigentlich alles, was es gerade braucht», sagt er.
Von Wäsche waschen bis Brustpanzer reparieren
Nebst Massagen ist Badertscher für die medizinische Betreuung der Spieler, das medizinische Material und die Koordination bei Unfällen und Verletzungen verantwortlich. Seine Arbeitstage sind lang, von 6.30 bis 22.30 Uhr ist er erreichbar, ständig klingelt sein Telefon.
Und damit ist er nicht allein. Trikots waschen und verteilen, Getränke vorbereiten, Tape oder sonstiges Material besorgen, Unfallmeldungen schreiben, verschiedenste Arzttermine buchen, Essen einpacken, Saunas oder Eisbäder bereitmachen, Tücher auslegen, nähen, Brustpanzer reparieren, stets erreichbar sein.
Während der Trainings ist immer mindestens ein Physiotherapeut oder eine Masseurin anwesend. Vor und nach den Trainingseinheiten kommen die Spieler zu ihnen.
Auch für das Packen des gesamten Materials bei Auswärtsspielen sind sie verantwortlich. Vom Massagetisch bis zum medizinischen Material muss alles mit. Sie fahren früher ab, damit alles bereit ist, wenn die Mannschaft ankommt. Meist zwei Stunden vor ihr.
«Ein Heimspiel ist locker 12 Stunden Arbeitszeit, ein Auswärtsspiel 16 bis 18.»
Sina Riva, Masseurin bei den SCRJ LakersDas gehört für die meisten dazu. «Da denke ich nicht drüber nach. Das ist für mich Alltag», sagt Isabel Knauthe. Seit dieser Saison ist sie Physiotherapeutin bei den SCL Tigers. Zuvor war sie fünf Jahre beim HC Davos bei der U-20-Elite. Ihre Stelle als «Medical Coordinator» ist neu vom Langnauer Club geschaffen worden und steht für alles Medizinische, das von der 1. Mannschaft zu ihr gelangt.
Sie sind das Bindeglied zwischen den Spielern, dem Teamarzt, den Coaches und Sportchefs. Für die meisten Themen und Probleme sind sie die erste Anlaufstelle. Nur selten sind sie nicht involviert, meist am Ursprung der Koordination und Organisation. «Der Job als Physiotherapeutin umfasst verschiedene Aufgaben, darunter auch solche, die nicht dem klassischen Berufsbild entsprechen», sagt Mirjam Müller. Sie ist seit Juli 2022 beim SC Bern in einem vierköpfigen Physiotherapie-Team tätig.
Je nach Club wird die medizinische Betreuung von ein und derselben Person gemacht. So beispielsweise in Kloten. Olivia Mainella arbeitet seit August 2020 beim Zürcher Club und ist dort allein für die Physiotherapien, Massagen und medizinische Betreuung der 29 Spieler zuständig.
Es braucht ein verständnisvolles Umfeld
Während der Saison sind die Tage lang. Während des Playoffs im Frühling noch länger und intensiver. Einen 8-bis-17-Uhr-Betrieb gibt es nicht. An Abenden und am Wochenende sind sie unterwegs, kommen erst frühmorgens von Auswärtsspielen zurück. «Ein Heimspiel ist locker 12 Stunden Arbeitszeit, ein Auswärtsspiel 16 bis 18», sagt Sina Riva, Masseurin bei den SCRJ Lakers.
Die Planung der Woche mit Beruflichem und Privatem hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Sie müssen viel flexibler sein, vorausplanen ist schwieriger geworden. Setzt der Trainer ein zusätzliches Training an, müssen sie anwesend sein. Anstatt nur Dienstag, Freitag und Samstag wird heute praktisch an allen Wochentagen gespielt. Schaffen es die Clubs in die Champions-Hockey-League, kommen noch mehr Weg-Tage dazu. «Das Fernsehen entscheidet heute, wann wir spielen. Es gibt keinen Rhythmus mehr», sagt Badertscher.
Der Aufwand sei viel grösser geworden. Die Spieler würden viel bewusster auf ihren Körper schauen, und es gebe mehr Spiele pro Saison, sagt er. Werden alle Vorbereitungsspiele und alle Partien der National League und Champions League zusammengerechnet, sind es etwa 75 pro Saison.
Entsprechend gross muss das Verständnis aus dem Umfeld der Masseure und Physiotherapeutinnen sein. Man brauche eine Familie, die mitmache, sagt Riva, «wenn man Kleinkinder hat, ist es fast nicht vereinbar». Auch der richtige Partner oder die richtige Partnerin ist wichtig. Arbeite dieser von 8 bis 17 Uhr, lebe man aneinander vorbei, sagt Martina Zurbuchen. Sie arbeitet seit 2016 als Masseurin beim EHC Biel.
Die ewige Frage nach dem Geschlecht
Eishockey ist noch immer ein männerlastiger Sport, die gesamte Eishockeywelt «ist sehr männerlastig», sagt Müller. In den 14 National-League-Clubs sind derzeit sechs als Masseurin oder Physiotherapeutin im Einsatz. Mehrheitlich in der deutschsprachigen Schweiz.
Ein selbstsicheres Auftreten und eine dicke Haut sind von Vorteil, um keine Plattform «für irgendwelche blöden Sprüche» zu bieten. Solche Sprüche kommen heute nur sehr selten vor – teilweise gar nicht. Kommen doch welche, «muss man einen dummen Spruch zurückgeben, und dann ist gut», sagt Zurbuchen.
Dass Mainella als Masseurin beim EHC Kloten arbeitet, war bei den Spielern nach dem zweiten Tag kein Thema mehr. «Da ist es völlig akzeptiert. Ich hatte gar nie Mühe in der Garderobe», sagt sie. Es ist ein Beruf, in dem die Fachkompetenz zählt – nicht das Geschlecht.
Gleich klingt es in Bern, Biel, Langnau und Rapperswil-Jona. «Es ist kein Unterschied, ob ich ein Mann oder eine Frau bin», sagt Müller. «Ich habe auch nie das Gefühl, dass sie denken ‹Zu ihr will ich nicht, weil sie eine Frau ist›.»
Für Knauthe werden gewisse Dinge, wie Frauen im Eishockey, zu sehr aufgebauscht. «Es kommt immer auf das gegenseitige Verständnis an», sagt sie. Denn mehrheitlich erhalte sie positive Reaktionen auf ihren Beruf und Bewunderung.
Im Sommer beginnt alles von vorne
Nach einer langen Saison und intensiven Playoffs haben sie im Sommer frei – bis zu einem gewissen Punkt. Verlässt ein Spieler das Team und sind noch Arztrechnungen offen, werden diese abgearbeitet. Im August beginnen die meisten Clubs mit Sommertrainings und Trainingslagern, an diesen sind sie ebenfalls anwesend.
Es sind die Emotionen, die ständigen Wechsel im Team, die neuen Persönlichkeiten, die zum Team stossen, der Kontakt zu den Spielern und das Gefühl einer zweiten Familie, die für sie das Schönste am Beruf sind. «Der Mensch in der Rüstung ist etwas, was mir fest am Herzen liegt», sagt Riva. Es ist also für alle eigentlich besser, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer sie in ihrer gelben Kleidung nicht zu Gesicht bekommen – aber den Wert ihrer Arbeit sehen lernen.