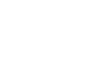Schön das sich der ZSC auswärts nicht der NHL anpasst, War wieder einmal schön rauchig wie im alten Hasta, aus nostalgischer Sicht top 🥳🤟
Beiträge von Ouimet
-
-
 Schweizer Athleten erzählen – Sind Skifahrer arme Schlucker? So lebt es sich im WeltcupViele Skifahrerinnen und Skifahrer kämpfen um jede Einnahmequelle. Die Ausgaben sind hoch, das Preisgeld oft ein Witz. Wie überleben sie?www.tagesanzeiger.ch
Schweizer Athleten erzählen – Sind Skifahrer arme Schlucker? So lebt es sich im WeltcupViele Skifahrerinnen und Skifahrer kämpfen um jede Einnahmequelle. Die Ausgaben sind hoch, das Preisgeld oft ein Witz. Wie überleben sie?www.tagesanzeiger.chSind Skifahrer arme Schlucker? So lebt es sich im Weltcup
Viele Skifahrerinnen und Skifahrer kämpfen um jede Einnahmequelle. Die Ausgaben sind hoch, das Preisgeld oft ein Witz. Wie überleben sie?
Es gab Tage, da kaufte sich Daniele Sette ein Ski-Billett, fuhr planlos den Berg hoch und bat eine Gruppe ausländischer Athleten, den einen oder anderen Trainingslauf mitfahren zu dürfen. Manchmal nahm er die Bohrmaschine gleich mit und steckte einen Kurs für sich selbst aus. Oft stand er vor einem Rennen bis nach Mitternacht in irgendeinem Keller und präparierte seine Ski.
Sette, 168 Zentimeter, wurde lange von vielen übersehen. Während 12 Jahren war der Bündner als Ein-Mann-Betrieb unterwegs im Skizirkus. Ohne Physiotherapeut, ohne Servicemann, ohne Kaderstatus. Während andere in der Massage lagen, bettelte er um eine Trainingspiste. Während sich die Konkurrenten im Restaurant einen Dreigänger gönnten, ging er im Supermarkt einkaufen. Der Bündner war sein eigenes Heinzelmännchen: Er buchte Reisen, kaufte Material, vertrat sich an den Mannschaftsführersitzungen, drehte Videoblogs für seine Unterstützer.
Im Sommer testete er nicht ausgiebig Ski, sondern arbeitete auf dem Bau und putzte Klinken, um Geld aufzutreiben. Er fuhr Rennen in Neuseeland, in Nordamerika, bis zu 50’000 Franken brauchte er pro Winter. Um Kosten zu sparen, lieh er sich alte Anzüge von Konkurrenten, schlief auch mal auf dem Sofa von Kollegen. Er wurde belächelt und als Paradiesvogel bezeichnet, schaffte es 2019 aber doch noch ins Swiss-Ski-Kader, mit 27 Jahren. Im Riesenslalom von Adelboden wird er am Samstag 23.
In einem Kader zu sein, bedeutet Sicherheit. Doch lässt sich auch Geld verdienen? Wie geht es den Athletinnen im Ranglistenmittelfeld? Fragen und Antworten zum Leben als Skirennfahrer.
Was wird bezahlt, wenn man im Kader ist?
Er sei gefragt worden, ob er überhaupt weiterfahren könne, erzählt Slalomspezialist Ramon Zenhäusern. Der Walliser fiel auf diese Saison aus dem Nationalteam und wurde ins A-Kader versetzt. Auf die Gruppeneinteilung und Trainingsbedingungen habe das keinen Einfluss, sagt er, «nur finanziell ein bisschen».
Sponsoren bezahlen oft nach Kaderzugehörigkeit unterschiedlich viel. Zudem übernimmt Swiss-Ski für Nationalteammitglieder – derzeit neun Athleten und sieben Athletinnen – ganz das Leasing der Autos, die vom Verband zur Verfügung gestellt werden. Je tiefer das Kader, desto höher der Anteil des Sportlers am Leasing. Auch stehen den Höchsteingestuften mehr Skikleider zu und ein besseres Handy-Abonnement. Neu bekommen sie für die Heimrennen Tickets, die sie ihren privaten Sponsoren weitergeben können. Die Unfallversicherung wird sämtlichen Kaderathleten bezahlt.
A-Kader-Fahrerin Andrea Ellenberger sagt: «Ich finde, es geht innerhalb des Verbandes allen gut, vom C-Kader bis zum Nationalteam.» Trainer und Physiotherapeuten stehen zur Verfügung, auch Kost und Logis an den Rennen und in den Trainingscamps werden vom Verband übernommen. Daniele Sette sagt: «Wenn du nicht im Kader bist, musst du über alles nachdenken und selber zahlen. Hast du es ins Kader geschafft, wird für dich gedacht.»
Was müssen Athletinnen dem Verband abgeben?
Wer in einem Swiss-Ski-Kader ist, muss dem Verband den Athletenbetrag von 3000 Franken pro Saison entrichten. Auch von den Einnahmen des persönlichen Kopfsponsors geht ein Teil an den Verband. Je höher die Kader-Stufe, desto höher dieser Betrag.
Riesenslalomfahrer Justin Murisier sagt es plakativ: «Ich wäre fast lieber im B-Kader als in der Nationalmannschaft.» Schliesslich kann auch ein starker B-Kader-Athlet in Weltcupgruppen trainieren, muss Swiss-Ski aber weniger bezahlen. «Ich verstehe dieses System aber schon», sagt Murisier, «wir haben als Junge auch davon profitiert.» Zudem kostet ein Kaderathlet Swiss-Ski pro Saison je nach Kaderstufe und abhängig von der Anzahl Disziplinen zwischen 75’000 und 240’000 Franken.
Einen Lohn vom Verband kassieren die Sportlerinnen und Sportler nicht. Zusammen mit Hauptsponsor Sunrise schüttet dieser jedoch Erfolgsprämien aus – jährlich rund eine Million Franken über alle elf Sportarten hinweg, vom Skispringer bis zur Biathletin. Ein paar Franken zu verdienen gibt es für die Alpinen auch für Rang 30 im Weltcup sowie für Spitzenergebnisse im zweitklassigen Europacup.
Bei Nachbar Österreich übrigens müssen die Athleten jeden Sponsoring-Deal offenlegen und einen Teil davon dem ÖSV abtreten. Allerdings werden sie von den Verbandssponsoren grösstenteils auch noch individuell unterstützt.
Welche beruflichen Auslagen haben Kader-Athleten sonst?
Swiss-Ski trägt den Grossteil der Reisekosten für Kaderzusammenzüge und für die Teilnahme an Wettkämpfen, für Upgrades bei Flügen müssen die Sportlerinnen und Sportler selbst aufkommen.
Viele Athleten haben zudem private Konditionstrainer, die sie selbst bezahlen – wie der verletzungsgeplagte Murisier. Oft reist er zu diesem aus dem Wallis nach Neuenburg, die Benzinkosten summieren sich. «Ich investiere das ganze Jahr in meinen Sport», sagt er. Muss er ins oberbayrische Schliersee, um seinen jüngst operierten Rücken zu therapieren, «kosten mich vier Tage 4000 Franken». Mit 60’000 Franken pro Jahr käme er niemals durch, sagt Murisier.
Besonders eng wurde es während der Zeit als Verletzter. Als Murisiers Kreuzband 2011 riss, war er versichert. Als er im Folgejahr wieder auf Schnee trainierte, ging es am vierten Tag erneut kaputt. Doch die Versicherung bezahlte keine Ausfallentschädigung mehr, weil es sich nicht um dieselbe Verletzung handelte. «Zum Glück wohnte ich bei meinen Eltern», sagt Murisier.
Was bedeutet es, nicht in einem Kader zu sein?
Plötzlich gab sich Swiss-Ski knausrig. Der Verband stellte Andrea Ellenberger noch eine einzige Skijacke zur Verfügung – und selbst diese nur leihweise. Als die Nidwaldnerin 2017 vom Rauswurf aus dem Kader erfuhr, war sie gerade am Rücken operiert worden. «Ich stand vor dem Nichts, hatte keinen Trainer mehr, keinen Servicemann, musste abklären, ob ich überhaupt noch Ski bekomme.»
Ein paar Sponsoren blieben ihr treu, sie konnte zu Hause wohnen, der Freund, ein Skitrainer bei Swiss-Ski, gab seinen Job auf, um sie zu begleiten. Mit ihm flog sie im Sommer 2018 für sechs Wochen nach Südamerika. «All in» nennt es Ellenberger, die letzte Hoffnung. Dank des Siegs im Südamerika-Cup schaffte sie es ins Schweizer Europacupteam, aufgrund ihrer Trainingsleistungen bekam sie im Weltcup ihre letzte Chance – und nutzte sie. Heute gehört sie zum A-Kader sowie den Top 25 im Riesenslalom und hat vor allem dank regionalen Partnern ein stabiles Umfeld.
Jahrelang auf sich allein gestellt war Daniele Sette. «Keiner schaut auf dich, keiner kümmert sich um dich», so umschreibt er das Leben ohne Kaderstatus. Es sei nur schon schwierig gewesen, überhaupt gewisse Rennen bestreiten zu dürfen. Kann sich ein Athlet für die drittklassigen FIS-Rennen selbst registrieren, erfolgt die Anmeldung für die Europa- und Weltcupbewerbe über den jeweiligen Landesverband. Dass diese ihre eigenen Schützlinge priorisieren, liegt auf der Hand.
Es sei ein ständiger Überlebenskampf gewesen, erzählt Sette. «Ich musste jedes Skibillett selber zahlen, alles alleine organisieren.» Im Sommer sei er mehr Manager als Athlet gewesen, weil er Tausende Franken für die nächste Saison auftreiben musste. «Nach dem Winter war ich fix und fertig, nahe am Burn-out.»
Wie relevant sind die Preisgelder?
565’000 Franken fuhr Marco Odermatt in der letzten Saison ein, Aleksander Kilde, Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova kassierten ebenfalls über 400’000. Es sind stolze Beträge, nur: Sechsstellig verdienten gerade mal 12 Männer und 14 Frauen.
Justin Murisier belegte im Preisgeld-Ranking der FIS Platz 34. 34’266 Franken landeten auf seinem Konto, ein überschaubarer Betrag für die Weltnummer 14 im Riesenslalom. Der Walliser sagt, er habe jüngst mit Gino Caviezel über die Thematik geredet – nach dessen 4. Platz im Super-G von Beaver Creek. Caviezels Lohn? 7500 Franken. «Damit zahlt man den Business-Flug, auf den viele Athleten mit Verletzungsgeschichten angewiesen sind. Mehr nicht. Wir sind kein Produkt, sondern Menschen, die auch leben müssen», sagt Murisier.
Auf diese Saison hin wurde das Preisgeld um zehn Prozent erhöht, auf 132’000 Franken pro Rennen. Eine Ausnahme bildet Kitzbühel, wo in den Abfahrten je 333’200 Franken ausgeschüttet werden. Unter den Geschlechtern herrscht Gleichberechtigung, den grossen Reibach aber machen nur die Besten. Für den Sieg gibt es in der Regel 50’000, für Platz 10 noch 2000 Franken.
Dass die Preisgelder für die weniger erfolgreichen Fahrer maximal ein Tropfen auf den heissen Stein sind, verdeutlicht sich am Beispiel von Daniele Sette: Er hat in seiner Karriere ganze 10’525 Franken Preisgeld verdient
Wie viel Wert hat das Kopfsponsoring?
Die 50 Quadratzentimeter auf dem Helm sind die wichtigste Vermarktungsfläche und Einnahmequelle für die Profis. Die Bandbreite ist dabei riesig. Fahrerinnen und Fahrer, die sich regelmässig in den Top 3 klassieren, erhalten von ihrem Kopfsponsor jährlich mittlere sechsstellige Beträge, selbst die Millionengrenze wird von wenigen geknackt. Auch für Athleten, die sich in den Regionen zwischen den Rängen 15 und 30 einer Disziplin bewegen, kann es lukrativ sein – 60’000 Franken pro Jahr sind keine Seltenheit.
Weitaus schwieriger wird es für Fahrer, die sich im Weltcup nicht in den Top 30 etabliert haben. Wer bei Swiss-Ski etwa im C-Kader ist, muss zufrieden sein, wenn er 10’000 bis 15’000 Franken erhält.
Welche Einschränkungen gibt es im Privatsponsoring?
Abgesehen vom Platz auf dem Helm gehört die gesamte Werbefläche dem Verband. Schliesst eine Fahrerin einen persönlichen Sponsoringvertrag ab, kann sie ihrem Partner keine Visibilität auf der Skijacke bieten. Erlaubt ist seit kurzem, im Training eine spezielle Startnummer zu tragen. Auf dieser müssen zwar die Partner des Verbandes ersichtlich sein, können aber auch persönliche Sponsoren präsentiert werden. Verbreitet werden die Bilder primär über Social Media.
Eine andere Möglichkeit bietet die Trinkflasche, die in kaum einem Fernsehinterview mehr fehlt. Sie darf maximal einen halben Liter fassen. Auch Partner aus der Uhrenbranche können präsentiert werden, Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Michelle Gisin, Marco Odermatt – sie alle tragen unmittelbar nach den Rennen auffällig schmucke Exemplare. Unkompliziert ist die Suche nach Sponsoren aber nicht. Die Premium-Partner des Verbands dürfen nicht konkurrenziert werden, womit die Auto-, die Versicherungs-, die Telekommunikations-, die Banken- und die Energiebranche wegfallen.
Ein Spezialfall ist Marco Odermatt. Auf der Website des Ausnahmefahrers ist mit Red Bull ein Hauptsponsor aufgeführt – hinzu kommen 19 Premium-Partner, 5 Ausrüster und 4 Supporter. Zu seinen Premium-Partnern gehören Sunrise, Descente, Raiffeisen, Reusch und Audi, Verbandssponsoren also, die mit Odermatt Einzelverträge abgeschlossen haben.
Welche Einnahmequellen gibt es sonst?
Der Ski-Ausrüster ist seit jeher wichtiger Geldgeber. Allerdings lag früher das Fixum höher, heute wird vor allem auf Erfolgsprämien gesetzt. Entsprechend schwierig ist es für Athletinnen ausserhalb der Top 15, einen lukrativen Kontrakt zu kriegen. Andrea Ellenberger sagt: «Es gibt Verträge, in denen Prämien festgelegt sind für Podestplätze. Den kann ich schon unterschreiben, nur habe ich nicht allzu viel davon.» Murisier sagt: «Heute muss man zur absoluten Weltspitze gehören, um mit der Ski-Firma gutes Geld zu verdienen. Früher reichte es, der Fünfzehnte einer Disziplin zu sein.» Derzeit darf ein solcher Fahrer mit einem fixen Betrag von rund 30’000 Franken rechnen. Von Stock- und Helmherstellern gibt es für den Durchschnittsweltcupfahrer längst nichts mehr.
Vorwiegend jüngere Schweizer Talente werden durch die Stiftung «Passion Schneesport» und «Dr.-Heinz-Grütter-Jundt-Stiftung» unterstützt, Letztere entstand nach der medaillenlosen WM 2005 in Bormio. Auch die Sporthilfe engagiert sich, Technik-Spezialist Fadri Janutin hat zudem als einziger Alpiner eine Stelle als Zeitmilitär-Spitzensportler erhalten. Als Sportsoldat bezieht er ganzjährig 50 Prozent Lohn. Mittlerweile können sich die Alpinen aber auch mehrere WK-Wochen pro Jahr anrechnen lassen, in denen sie Erwerbsersatz erhalten.
Können alle Athleten und Athletinnen im Weltcup Geld zur Seite legen?
Fahrer wie Justin Murisier, die sich seit jeher in den Top 15 oder gar Top 7 einer Disziplin halten, können für gewöhnlich Geld sparen. «Ich zeige wieder gute Leistungen, war kaum mehr verletzt und brauche nicht mehr so viel Therapie, daher kann ich derzeit Geld auf die Seite tun», sagt der 30-Jährige.
Seit der Aufnahme ins Kader ist auch Daniele Sette aus dem Gröbsten raus. Skifahren ist für ihn nun kein Minusgeschäft mehr, «eine Familie ernähren könnte ich mit meinem Verdienst aber sicher nicht. Zumal die Einnahmen der Sponsoren sehr unterschiedlich und nicht auf Jahre hinaus garantiert sind.»
Wer sich mit Managern in der Szene unterhält, kommt zum Schluss, dass gerade Athletinnen und Athleten ausserhalb der Top 30 einer Disziplin deutlich mehr verdienen würden, wenn sie einer herkömmlichen Arbeit nachgehen würden. Es gibt denn auch welche, die im Sommer zumindest ein paar Wochen lang ihren erlernten Beruf ausüben, um zusätzliches Geld zu verdienen.
Es gibt auch Fahrer, die auf Crowdfunding-Projekte setzen. Derweil Sette durch die Gemeinde St. Moritz und von vielen Gönnern unterstützt wird. Sicher ist: Die Schere zwischen Arm und Reich ist im Skisport seit der Jahrtausendwende grösser geworden.
-
Noch ein Drittel in Kloten und fertig war das Feuerwerk 😂😂😂..
Erinnert mich stark an einen Zürcher Club..
Zug ist aber auch im CHL Halbfinal… würde ich sehr gerne tauschen…
-
Bis auf Wallmark hatte Rappi auch die besseren Ausländer. Die machen aus Scheisse mindestens Silber. Wir machen aus Gold einen verwirrten Hühnerhaufen.
…. Und das mit viel weniger Budget! Wie lange läuft der Vertrag mit SL noch?
btw; was wäre hier los gewesen hätte RG an einem Wochenende 0 Punkte geholt gegen die Aufsteiger von 2021 und 2018….
-
RG hat sicher noch ein paar Bananenschachteln übrig für Crawford…
-
 Unterschiedliche Hockeykultur – Warum die Schweden in der Schweiz immer wieder scheiternFünf Jahre vor Rikard Grönborg wurde Hans Wallson beim ZSC entlassen. Er erinnert sich an Herausforderungen, die auch der beim SCB gefeuerte Johan Lundskog…www.tagesanzeiger.ch
Unterschiedliche Hockeykultur – Warum die Schweden in der Schweiz immer wieder scheiternFünf Jahre vor Rikard Grönborg wurde Hans Wallson beim ZSC entlassen. Er erinnert sich an Herausforderungen, die auch der beim SCB gefeuerte Johan Lundskog…www.tagesanzeiger.chWarum die Schweden in der Schweiz immer wieder scheitern
Fünf Jahre vor Rikard Grönborg wurde Hans Wallson beim ZSC entlassen. Er erinnert sich an Herausforderungen, die auch der beim SCB gefeuerte Johan Lundskog nennt.
Es kann manchmal so einfach sein. Die ZSC Lions haben am 28. Dezember Rikard Grönborg in dessen vierter Saison als Cheftrainer entlassen, bei der Nachfolge an die Vergangenheit gedacht und den 61-jährigen Kanadier Marc Crawford verpflichtet, der bereits vor zehn Jahren die Zürcher coachte. Wenn der Schwede nicht funktioniert, dann muss ein Nordamerikaner her.
Dieser Gedankengang ist nicht neu, auch rund um den SC Bern schwärmten die Anhänger während der letzten beiden Saisons unter Johan Lundskog von den guten alten Zeiten mit Kanadiern an der Bande. Nicht alle sportlichen Führungen ticken genau gleich, Lundskog wurde zwar ersetzt, aber durch den Finnen Toni Söderholm.
Im Meisterjahr entlassen
Warum aber sollen schwedische Trainer in der Schweiz nicht funktionieren? Oder wo liegen zumindest die Probleme? Fast auf den Tag genau fünf Jahre vor Grönborg, am 29. Dezember 2017, war schon Hans Wallson bei den ZSC Lions entlassen worden. Der Kanadier Hans Kossmann übernahm und feierte am Ende der Saison den bisher letzten Meistertitel für die Zürcher.
Wallson hatte die Lions in seiner zweiten Saison verlassen müssen, aktuell ist er bei Spengler-Cup-Teilnehmer Sparta Prag angestellt, er ist damit der erste schwedische Trainer überhaupt in Tschechien. Wallson erinnert sich an seine Entlassung, die für ihn nicht ganz überraschend gekommen sei: «Ich nahm in der zweiten Saison eine grundsätzlich gestresstere Stimmung im Club wahr als in der ersten.»
«Ich war in der Schweiz gefasst auf Unterschiede. Ich war aber überrascht, wie gross diese dann waren.»
Hans Wallson zum Start in Zürich 2016Er erinnert sich aber vor allem an seinen Start in Zürich. Er kam aus Skelleftea, dem Vorzeige-Ausbildungsclub Schwedens, in dem auch Wallson selbst gross geworden und via Junioren-Teams zum Cheftrainer aufgestiegen war. Seine Bilanz in den vier Saisons in der SHL: viermal Rang 1 in der Qualifikation, zwei Meistertitel, zwei weitere Finalteilnahmen. Kein Wunder, ist da ein Trainer überzeugt von seiner Arbeitsweise.
Und es sei nicht so, dass er sich nicht über die Schweiz und das NL-Eishockey erkundigt habe: «Ich war gefasst auf Unterschiede», sagt Wallson, «ich war aber überrascht, wie gross diese dann waren.» Er erzählt von seiner Herangehensweise, die nicht unähnlich tönt, wenn Grönborg oder Lundskog sprechen: «Ich kam aus einer Umgebung, in der du Spieler auch lehrst, Teil des Prozesses zu sein.» Könnte er die Zeit zurückdrehen und 2017 nochmals in Zürich starten: Würde er die Aufgabe anders angehen? Wallson lacht und sagt: «Ich würde komplett anders starten.»
Zum Beispiel? «Weniger kommunizieren bei den Anweisungen, weniger involvieren. Sagen: So ist es und fertig.» Wallson betont, dass seine Zeit in der Schweiz schon fünf Jahre her sei und er darum keine Schlüsse auf die heutige Situation ziehen wolle. Aber damals habe er klare Hierarchien gespürt: «Headcoach, Assistenzcoach, Spieler. In Schweden arbeiteten wir mehr zusammen – der Cheftrainer war vielleicht bloss häufiger in den Medien.» Interessant: Lundskog sagte letzten Sommer nach seinem ersten Jahr in Bern betreffend Dinge, die er anders hätte machen sollen, Ähnliches: «Ich muss direkter werden. Du musst hier auch permanent antreiben.»
Die Generationenfrage will Wallson auch nicht ausblenden – und da ist vielleicht auch in der Schweiz ein klitzekleiner Unterschied bereits festzustellen im Vergleich zu seinem Start in Zürich im Sommer 2016: «Wir sehen auch in Schweden, dass die jüngeren Spieler eine andere Mentalität haben, wissbegieriger sind, grösser träumen und immer härter für diese Träume arbeiten. Sie wollen auch Wege finden, wie sie besser werden, und nicht nur darauf warten, dass ihnen alles gesagt wird.»
Die Hilfe für den Start in Prag
Wallson betont, dass er die Erfahrung in Zürich keinesfalls bereue: «Du kannst nicht dein ganzes Leben gewinnen, du lernst so viel aus Niederlagen, auch aus Entlassungen.» Als er zu Beginn dieser Saison bei Sparta Prag anheuerte, halfen ihm seine Erfahrungen aus den ZSC-Zeiten bereits: «Die tschechischen Spieler sind bezüglich ihrer Mentalität den Schweizern näher als den Schweden. Zwar diskutieren wir bei Sparta auch mit ihnen, aber wir entscheiden eher klarer.»
Er sagt nicht ohne Grund «wir», denn Wallson ist bei Sparta Prag nicht Headcoach im klassischen Sinn, sondern gemeinsam mit Miloslav Horava Co-Trainer. Die beiden teilen sich sogar die Auftritte an den Medienkonferenzen auf, mal geht der eine, mal der andere. «Die gemeinsame Arbeit war der Wunsch von Milo», sagt Wallson. «Es ist für die Spieler gut, wenn sie nicht immer nur die gleiche Stimme hören.»
Von seinem schwedischen Ansatz ist er nicht ganz abgewichen: «Wir versuchen ein Stück weit schon, die Spieler in die Entscheide miteinzubeziehen.» Weil er sicher ist: «Wenn du in der Organisation vom wirklich grossen Bild sprichst und nicht nur von der Aktualität, dann kannst du nur so erfolgreich sein.»
«Teil des Prozesses zu sein, bedeutet für den Spieler auch, Verantwortung bei Niederlagen zu übernehmen und nicht nur auf die Trainer zu zeigen.»
Hans Wallson, Co-Trainer Sparta PragVielleicht scheiterten in der Schweiz in den letzten Jahren auffallend oft skandinavische Trainer aus ähnlichen Gründen. Die Begründungen waren jeweils ähnlich: Sie hätten das Team mit ihren Methoden nicht mehr erreicht, die Entwicklung der Mannschaft sei in Gefahr gewesen. Doch bei all diesen häufig auch pauschalisierenden Erklärungen wird oft vergessen, dass es viele Gegenbeispiele gibt. Und zwar nicht nur für nicht funktionierende Nordamerikaner von früher.
Der SCB feierte seine letzten grossen Erfolge mit dem Finnen Kari Jalonen unter einem Nordländer. Der EV Zug wurde zuletzt zweimal unter dem Norweger Dan Tangnes Meister, der in seinen Methoden als Schwede durchgeht: Sein ganzes Handwerk hat er in seiner zweiten Heimat gelernt. Und die Rapperswil-Jona Lakers spielen unter Stefan Hedlund schon die zweite Saison auf einem höheren Level, als man es angesichts der Kaderstärke vermuten würde.
Es könnte also dann und wann auch andere Gründe für unbefriedigende Resultate geben als bloss den schwedischen Coach und seine von Zynikern auch als «sozialistisch» bezeichneten Methoden. Oder wie es Wallson sagt: «Teil des Prozesses zu sein, bedeutet für den Spieler auch, Verantwortung bei Niederlagen zu übernehmen und nicht nur auf die Trainer zu zeigen – auch wenn das natürlich sehr einfach ist.»
-
Back to topic. Das mit den Sponsoren kann schon rufschädigend sein.
Der FCZ hatte mit Ante Pay eine sehr merkwürdige Organisation als Sponsor:
 Der Fall AntePAYWie der FC Zürich zu einem Trikotsponsor aus dem Dunstkreis der organisierten Kriminalität kam. Und wer hinter dem Millionengeschäft mit den illegalen…reflekt.ch
Der Fall AntePAYWie der FC Zürich zu einem Trikotsponsor aus dem Dunstkreis der organisierten Kriminalität kam. Und wer hinter dem Millionengeschäft mit den illegalen…reflekt.chDer EVZ hat das Sponsoring mit Nord Stream aufgelöst.
Sollte an den Vorwürfen mit ImmoZins etwas dran sein wäre es nicht verkehrt ab sofort auf das Sponsoring zu verzichten. Der ZSC hat eine nationale Ausstrahlung und Vorbildfunktion und ist auf das Geld jetzt auch weniger angewiesen als der FC Wil. Ausserdem hat man mit dem Bau der SLA auch eine gewisse Erfahrung als Bauherr.
Tumult an Weihnachtsfeier von Immobilien-Startup - Inside ParadeplatzUnzufriedene Kunden des Jung-Unternehmens ImmoZins stören Xmas-Feier. Investoren zeigen sich verunsichert, Firma will Ball flach halten.insideparadeplatz.chUnd vielleicht sollte man solche Engagements such kritischer prüfen „Für Roger Gemperle, CMO der ZSC Lions, ist die neue Partnerschaft mit der ImmoZins AG ein starkes Signal: «Auch in der aktuellen Zeit werden die ZSC Lions als solider Partner wahrgenommen, wie dieses tolle Engagement zeigt. Das junge Zürcher Startup-Unternehmen hat uns überzeugt. Wir sind sehr glücklich, die ImmoZins AG als neuer Hauptsponsor begrüssen zu dürfen, und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!»
Das der ZSC Sponsoring Angebote auch ausschlagen kann haben sie ja bewiesen.
 Fremdgeh-Portal wollte Crosby zum ZSC bringenEin kanadisches Unternehmen offerierte den ZSC Lions ein Gastspiel des ultimativen NHL-Superstars Sidney Crosby – und die Zürcher haben abgelehnt.amp.20min.ch
Fremdgeh-Portal wollte Crosby zum ZSC bringenEin kanadisches Unternehmen offerierte den ZSC Lions ein Gastspiel des ultimativen NHL-Superstars Sidney Crosby – und die Zürcher haben abgelehnt.amp.20min.chAber warum haben die ZSC Lions die an einem Sponsoring interessierte kanadische Firma abgelehnt? «Weil wir es uns ganz einfach nicht leisten können, für diese Firma Werbung zu machen. Wir haben unter unseren Kunden schliesslich auch seriöse Familienväter.»
Die ZSC Lions haben gemäss Peter Zahner sozusagen ein «unmoralisches Angebot» abgelehnt. Bei der an einem Sponsoring interessierten kanadischen Firma handelt es sich nämlich um das in Kanada berühmte Fremdgehportal AshleyMadison.com (Slogan: «Das Leben ist kurz, gönne Dir eine Affäre») und wird nach eigenen Angaben weltweit von über 15 Millionen Besuchern genutzt (Heiliger Bimbam!).
-
Klar. Nachher hat er halt abgehoben, glaubte er sei Gott. Ist aber m.E. das Problem der Raiffeisen gewesen. Denke immer noch er muss mit einem Freispruch davon kommen, aber vermutlich muss man dem Volk ein Opfer dar bringen: Seht her, wir verurteilen nicht nur kleine Fische!
Horta-Osorio hat in dem halben Jahr bei der CS wohl mehr Spesen mit seinen Ferienflügen verbraten als Vincenz in 20 Jahren Raiffeisen. Für mich müsste er auch mit einem Freispruch davon kommen. Ausserdem hat er kein Schlachtfeld hinterlassen sondern aus der Bauernbank die Nr. 3 der Schweiz gebaut.
-
Üble Nachrede. Er beleidigt die Leute bei der CS und in den Kommentaren geht das dann weiter. Jeder dort ist ein Volltrottel, ein Clown, etc. pp.
Der Fall Vinzenz ist so ziemlich die Ausnahme der Regel! Ist reines Bashing und in den Kommentaren bashen dann frustrierte kleine Fische dieser Firmen kräftig mit.
Ich mag LH auch nicht, für mich auch zuviel Artikel über Schwurbler und Covid Lügner. Aber es ist meistens mehr dahinter als man denkt und nicht nur bei Vincenz. Wobei Vincenz hat mal ausser den Spesen einen super Job gemacht dies im Gegensatz zu einem Urs Rohner…
Das hat LH auch aufgedeckt:
 Vermeintlicher Skandal bei EY: Heute alles in neuem LichtAusgerechnet die Auditfirma, die Konzerne wie Ems, Nestlé oder UBS kontrolliert, geriet in einen Shitstorm. Entfacht vom eigenen Kader.www.handelszeitung.ch
Vermeintlicher Skandal bei EY: Heute alles in neuem LichtAusgerechnet die Auditfirma, die Konzerne wie Ems, Nestlé oder UBS kontrolliert, geriet in einen Shitstorm. Entfacht vom eigenen Kader.www.handelszeitung.chBack to topic aber, wieso überprüft der ZSC seine Sponsoren nicht? 11% Zins tönt jetzt echt nicht seriös. Erinnert mich an ante pay beim fcz
-
Neues von unserem Leibchensponsor…
Die kreative Buchhaltung des ImmoZins-CEOs - Inside ParadeplatzVor 10 Jahren fielen UBS&Co. auf die Nase: Falsche Rechnungen, falsche Verbuchungen, Urkundenfälschung. Prominent drin: Louis-Philippe Müller.insideparadeplatz.ch -
Hier im Forum zählen ja jeweils nur Titel. Wenn man die Statistik von Crawford so anschaut, holte er in seiner Trainerkarriere seit Anfang der 1990er Jahre gerade einmal zwei Meistertitel (1x Stanley Cup, 1x CH-Meisterschaft) und wurde schon mehrfach entlassen... Ist das jetzt wirklich das Profil eines Heilsbringers?
+ Cupsieg

-
Und Kevin Schläpfer
Christian Weber
-
Schon wieder eine Stelle frei….
Lass uns doch jemand vom Forum einschleusen, der wird ja dort ganz interessante Zahlen sehen…
 Wir suchen: Sachbearbeiter/In AccountingFür das Finanz- und HR-Team suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n* SachbearbeiterIn Accounting.www.zsclions.ch
Wir suchen: Sachbearbeiter/In AccountingFür das Finanz- und HR-Team suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n* SachbearbeiterIn Accounting.www.zsclions.ch -
Die letzte Patrone von SL. Wenn die nicht sitzt ist er dann hoffentlich auch Geschichte.
-
Mit Crawford wird
Und das kommt noch dazu, die Vertragslänge. Wenn das in die Hose geht, wird es aber teuer für den ZSC.
spielt ja nicht so eine Rolle ...
-
va bis 2025 ist jetzt auch etwas gar lang…Innovativere Ideen hatte SL nicht?
-
Bin gespannt ob der Trainerwechsel was ausmacht mit den Spielern oder ob es wirklich einfach an der Mannschaft liegt...
Ich auch. Weder Wallson noch Grönborg kamen mit der ZSC DNA klar… eigentlich ein Armutszeugnis für die Organisation….
-
Hättet ihr Formenton engagiert?
Damn ist das schwierig .............
Ich - tendenziell eher nein.
Mich wundert der Transfer von Ambri. Ambri hat doch eine sehr linke Fanszene die sich gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie sowie faschistische Aktivitäten einsetzt.
Daher steht dieser Transfer für mich etwas schräg in der Landschaft…
Aber auch bei uns hat sich diesbezüglich einiges getan Sprüche wie „Schwuler Pavoni“ gäbe es heute nicht mehr…
-
In der Schweizer National League beträgt der Lohn eines Assistenztrainers zwischen 70 000 und 120 000 Franken.
Krass, da hätte ich jetzt das doppelte erwartet….
-
 Pauli Jaks im Interview – «Ich verstehe bis heute nicht, warum das passierte»Einst war er der erste Schweizer in der NHL, vor elf Jahren beging sein Bruder Peter Suizid. Ambris Goalie-Legende über sein Leben und die Verarbeitung dieses…www.tagesanzeiger.ch
Pauli Jaks im Interview – «Ich verstehe bis heute nicht, warum das passierte»Einst war er der erste Schweizer in der NHL, vor elf Jahren beging sein Bruder Peter Suizid. Ambris Goalie-Legende über sein Leben und die Verarbeitung dieses…www.tagesanzeiger.ch«Ich verstehe bis heute nicht, warum das passierte»
Einst war er der erste Schweizer in der NHL, vor elf Jahren beging sein Bruder Peter Suizid. Ambris Goalie-Legende über sein Leben und die Verarbeitung dieses Schicksalsschlages.
Was wir gleich klären müssen, Herr Jaks: Sie, die Tessiner Goalielegende, sind gemäss offiziellen Daten ein Schaffhauser!
Ja, ich kam dort auf die Welt. Meine Eltern flohen 1968 aus der Tschechoslowakei mit meinem damals zweijährigen Bruder Peter vor den Sowjets in die Schweiz. Sie landeten via Basel in Schaffhausen, weil mein Vater dort als Eishockeytrainer Arbeit fand. Dort kam ich 1972 auf die Welt. Vier Jahre später zogen wir nach Bellinzona, wo mein Vater das lokale Team trainieren konnte. Darum fühle ich mich durch und durch als Tessiner. Im Ticino machten sie aus Paul, wie ich eigentlich heisse, Pauli. Und auch im Tessin, beim Beobachten der Torhüter auf der offenen Eisbahn in Bellinzona, entdeckte ich die Leidenschaft für das Spiel der Goalies.
Und um ein Haar wären Sie nicht Torwart geworden.
Ja, weil ich Linkshänder war und folglich einen Fanghandschuh für die rechte Hand brauchte. Das war damals noch speziell, mein Vater befürchtete, dass wir keine passende Ausrüstung für mich finden würden. Doch der Materialwart von Bellinzona, der übrigens noch heute im Amt ist, half uns. Von da an war ich Goalie, meine Vorbilder waren Jiri Kralik, der Weltmeister von 1985, sowie der Davoser Richard Bucher.
Es ging dann alles sehr schnell. Mit 17 schon spielten Sie in der NLA, mit 21 wechselten Sie nach Nordamerika – für Goalies beides in sehr jungem Alter.
Ich wusste früh, was ich wollte: Profi werden. Ich wurde 1991 von den Los Angeles Kings gedraftet, im Sommer nach der U-20-WM, an der ich ins All-Star-Team gewählt worden war. Es war nicht vergleichbar mit der heutigen Zeit, in der man sich im Internet über alles informieren kann. Ich bekam weder den Draft mit, noch wusste ich, was es genau bedeutete, «gedraftet» zu sein. Es war mein Vater, der von meinem Draft hörte und es mir dann auch erklärte. Zwei Jahre später wagte ich den Schritt nach Nordamerika. Und auch da galt: Ich hatte keine Ahnung, keine Informationen, was mich da erwarten würde. (lacht)
Sie landeten im ersten Jahr in der Wüste Arizonas, in Phoenix, beim damaligen Farmteam der Kings.
Im ersten Jahr lief es gut, im zweiten war es etwas schwieriger: Es war die Lockout-Saison 1994/95, die NHL begann darum erst im Januar, bis dann kamen viele junge NHL-Spieler ins Farmteam, da brauchte ich Geduld. Kaum begann die NHL, hatte ich aber Glück im Unglück, weil sich die beiden Goalies der Kings verletzten. Ich musste sofort nach Los Angeles, um als Ersatzgoalie in einem Heimspiel gegen Chicago auszuhelfen. Dann lagen wir nach dem ersten Drittel 1:4 zurück, und der Trainer sagte mir in der Pause: «Pauli, du gehst jetzt ins Tor!» So kam ich zu meinem NHL-Einsatz. Was schön war: Mein Vater war zufällig genau in jener Woche in den USA auf einer Reise, so konnte er mein Debüt live im Stadion schauen.
«Heute blicke ich mit einem guten Gefühl zurück. Der Erste in der NHL zu sein, ist etwas Schönes, etwas, das mir immer bleiben wird.»
Es war der 29. Januar 1995. Sie schrieben Schweizer Sportgeschichte als erster Schweizer in einem NHL-Match.
Das war mir in jenem Moment gar nicht so bewusst. Es war ja eine andere Zeit. Die ersten Mobiltelefone kamen da erst auf, ich hatte nicht einmal einen Computer, um mich zu informieren. Heute blicke ich aber mit einem guten Gefühl zurück. Der Erste zu sein, ist etwas Schönes, etwas, das mir immer bleiben wird. Ich hatte zudem Super-Mitspieler in jenem Match: Wayne Gretzky, Jari Kurri, Luc Robitaille, Rob Blake, Tony Granato, Marty McSorley – das ist unglaublich, das war perfekt! Aber auch diese Dimensionen waren mir damals nicht so klar. NHL-Bilder kannte ich zuvor nur von VHS-Kassetten. (lacht) Übrigens: Mein Spiel wurde am TV übertragen, darum habe ich eine Kassette davon erhalten. Später konnte ich sie auf eine DVD überspielen lassen.
Sie waren Abenteuern nicht abgeneigt: Zehn Jahre später wechselten Sie völlig überraschend als erst zweiter Schweizer Goalie in Russlands höchste Liga.
Ich hatte in Ambri eine schlechte Saison hinter mir. Ich dachte mir: Das ist meine letzte Chance, so ein Abenteuer in einer anderen Kultur zu erleben. Meine Kinder waren noch klein, mussten noch nicht in die Schule. Meine damalige Ehefrau war einverstanden, ich nahm die Familie also mit. Man versprach mir vieles, zum Beispiel, dass die Kinder in einen Kindergarten gehen könnten mit englischsprachigen Lehrerinnen. Das stimmte dann natürlich alles nicht. (lacht) Aber es war dennoch eine sehr gute Erfahrung, sowohl menschlich als auch sportlich.
Sie waren ja nicht in Moskau oder in St. Petersburg, den damaligen russischen Wunschdestinationen von westeuropäischen Spielern.
Nein, ich war in Omsk, in Sibirien. Von dort kam halt das Angebot. Und bis November war es zwar kalt, aber nicht extrem. Spiele im Winter in der alten Valascia in Ambri hatte ich als kälter empfunden. Und ich konnte leider nicht lange bleiben. Es war 2004/05, also wieder eine Lockout-Saison in der NHL. Als dann im November plötzlich NHL-Stars in unser Team wechselten, zum Beispiel Jaromir Jagr, mussten einige der anderen Spieler gehen. Es gab eine Ausländerbeschränkung, und so traf es mich als Schweizer halt auch.
Sie wurden für viele junge Torhüter zum Vorbild. Wissen Sie, welcher aktuelle NLA-Goalie als allererstes Fan-Leibchen ein Pauli-Jaks-Jersey hatte?
Nein. (lacht)
«Du willst, dass es deinen Goalies gut geht, auch auf der menschlichen Ebene. Es geht darum, sie mental zu stärken.»
Nationalgoalie Leonardo Genoni!
Wirklich?
Ja. Sein älterer Bruder Gaetano hatte eines von Ihrem Bruder Peter, sein kleiner Bruder Tiziano eines von Oleg Petrov. Alles Ambri-Legenden.
Dass sie Ambri-Fans waren, wusste ich. Aber das von den Jerseys nicht. Wow! Das freut mich wirklich, da bekomme ich gleich Hühnerhaut.
Sie wurden unmittelbar nach der Karriere Goalietrainer. Einmal Goalie, immer Goalie?
Ich hatte im Nachwuchs Ambris zu Beginn nebenbei auch «normale» Trainerjobs, aber der Goalie-Teil war immer dabei. Ich wollte im Eishockey bleiben und den Jungen meine vielen Erfahrungen weitergeben. Ich komme auch mit 50 immer noch jeden Tag mit Freude in die Eishalle und arbeite genauso gerne mit den Goalies der 1. Mannschaft, wie auch mit den Nachwuchs-Torhütern. Ich selbst hatte in meiner Spielerkarriere ja erst spät einen richtigen Goalietrainer, vorher brachte ich mir das meiste selber bei. Einmal durfte im Training eine Weile ein Verteidiger auf mich schiessen, weil er einen extrem harten Schuss hatte. Das war damals halt normal.
Heute müssen Goalietrainer individuell auf ihre Spieler eingehen … Sie zum Beispiel haben mit Benjamin Conz und Janne Juvonen zwei Torhüter bei Ambri mit komplett unterschiedlichen Spielstilen.
Das ist so. Ich versuche bei routinierten Profis aber auch nicht, ihr Spiel komplett zu ändern, nur anzupassen.
Wie sehr sind Sie Psychologe? Conz hat derzeit deutlich schlechtere Statistiken als Juvonen - wie bauen Sie ihn auf?
Statistiken sind wichtig, aber nicht alles. Wichtig ist darum, dass ich mit den Goalies nicht nur über Eishockey rede. Sondern auch über das Leben, über Privates. Als Goalietrainer arbeitest du meistens mit nur zwei Spielern pro Team zusammen. Du willst, dass es ihnen gut geht, auch auf der menschlichen Ebene. Es geht darum, sie mental zu stärken. Im Sommer zum Beispiel unternehmen wir auch ausserhalb des Eishockeys Dinge zusammen: Tennis, Paddle oder Squash, da bin ich dann auch dabei. Und wie gesagt: Ich will ihnen auch Lebenserfahrung vermitteln.
Zu Ihrer Lebenserfahrung gehören auch die ganzen Umstände rund um den Tod Ihres Bruders Peter, auch er ein früherer grosser Eishockeyspieler in der Schweiz, der aber 2011 als 45-Jähriger durch Suizid aus dem Leben schied.
Es gelingt mir mittlerweile immer besser, damit umzugehen. Zunächst war das sehr schwierig. Er war ja nicht nur mein Bruder, sondern auch ein sehr guter Freund. Wir hatten so viel miteinander zu tun, auch neben dem Eis. Ich erinnere mich auch daran, wie wir viel gemeinsam lachten, wenn wir uns zu einem Kaffee trafen. Und plötzlich war er nicht mehr da. Wenn ich zurückdenke, verstehe ich bis heute nicht, warum das passierte. Dann frage ich mich, ob ich mehr hätte machen können. Ob ich es hätte ahnen müssen, dass etwas nicht mehr stimmte mit Peter.
«Wenn du zu lange nach einer Antwort suchst, bekommst du höchstens Kopfschmerzen. Peter hat sich so entschieden, man muss es akzeptieren.»
Diese Frage nach dem Warum werden Sie wohl nie beantworten können.
Nein, und wenn du zu lange nach einer Antwort suchst, bekommst du höchstens Kopfschmerzen. Er hat sich so entschieden, man muss es akzeptieren. Schon so viele Freunde und Kollegen, auch hier bei Ambri im Staff, haben mir auch gesagt: «Nein, du konntest das nicht ahnen! Lass es sein, weil es sonst nur schlimmer wird!» Und sie haben recht. Schwieriger ist es für meine Mutter (Pauli Jaks’ Vater Peter senior verstarb bereits 1998, die Red.), weil sie einen ihrer Söhne nicht mehr hat. Wir sind nun zu zweit, wir haben die schönen Erinnerungen, die helfen und uns stärker machen.
Kamen Sie sich näher?
Ja, nicht nur wegen Peters Tod. Meine Eltern gingen 1998 zurück nach Tschechien, wollten im Alter in der Heimat sein und dort noch ein schönes Leben führen. Meine Mutter kam vor sechs Jahren zurück in die Schweiz, weil alle ihre Angehörigen hier sind. Sie wohnt im Tessin unweit von mir. Sie ist mittlerweile 80, wir hören uns jeden Tag, ich helfe ihr zum Beispiel bei den Einkäufen.
Peter verstarb in jener Zeit, als Sie für eine Weile nicht im Tessin, sondern im Wallis bei Sierre Goalietrainer waren.
Ja, Sierre war damals eine Art Farmteam von Ambri. Ich erinnere mich an spätere Fahrten vom Tessin ins Wallis, als ich im Auto Zeit hatte für die Gedanken, für die Trauer und für die Tränen.
Das war in den Tagen unmittelbar vor und nach Peters Tod noch anders. Man findet in den Zeitungsarchiven viele Artikel aus den Tagen, an denen Ihr Bruder noch als vermisst galt. Für Tessiner Medien wurden Sie da zur Ansprechperson, die über den Stand der Ermittlungen Auskunft geben musste.
Du funktionierst einfach, bist wie in Trance. Du hast gar keine Zeit für Emotionen, hast so viel zu tun. Es war ein Sonntagabend, als mich seine Kinder anriefen, dass sie Peter nicht mehr erreichen konnten. Er hatte gesagt, dass er unsere Mutter in Tschechien besuche, nahm aber das Handy nicht mehr ab. Ich war gerade in Bellinzona, wo wir beide wohnten. Ich ging vorbei, fand ihn nicht und ging zur Polizei, um eine Vermisstmeldung aufzugeben. Man fand ihn erst ein paar Tage später in Italien. Danach half ich auch seinen Töchtern, seiner Ex-Frau, meinen Kindern. Und man musste auch die Beerdigung organisieren. Die Zeit zum Herunterfahren, zum Trauern, die kam erst später.
Über Peters Tod wollten Sie früher nicht reden. Hilft es Ihnen mittlerweile sogar, darüber zu sprechen?
Ja, ich denke schon. Ich habe kein Problem mehr damit, ich habe sogar Freude, über Peter zu reden. Die Zeit hat natürlich geholfen.