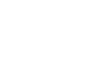- Offizieller Beitrag
Güllen! Soo Geil! ![]()
![]()
![]()
Güllen! Soo Geil! ![]()
![]()
![]()
nzz am sunntig:
Am Rande der Unsterblichkeit
Der FC Liverpool dominiert die Premier League und steht vor dem ersten Meistertitel seit 1990. Trainer Jürgen Klopp ist ein begnadeter Motivator, doch das erklärt den Durchmarsch nur zum Teil. Die Reds profitieren von seinem jahrelangen Feilen an allen erdenklichen Details – und raffinierten Transfers. Von Raphael Honigstein, London
Wie lebt es sich, wenn einem die Welt zu Füssen liegt? Jürgen Klopp ist genötigt, diese Frage in leicht modifizierter Form seit Monaten fast täglich aufs Neue zu beantworten. Seine Mannschaft steuert nicht nur auf einen mittlerweile fast schon sicheren Titel zu: Sie ist drauf und dran, Millionen von Anhängern der Reds auf der Insel und dem Rest der Welt von einem drei Jahrzehnte währenden Trauma zu erlösen. Die Rückkehr ins «gelobte Land» der Meisterschaft, wie es die Fans der Reds an der Mersey mit heiliger Leidenschaft formulieren, steht kurz bevor.
Klopp wusste selbstverständlich um das nahezu biblische Ausmass seiner Mission, als er im Oktober 2015 antrat, den demoralisiert im Tabellen-Nirgendwo verlorenen Traditionsklub wieder ganz nach oben zu bringen. Er komme nicht als «Messias», sondern als der «normal one» aus dem Schwarzwald, beschied er seiner Gemeinde zum Einstand, betonte aber gleichzeitig im Duktus eines Wanderpredigers, dass «aus Zweiflern Gläubige» werden müssten, es gelte «den 20 Kilo schweren Rucksack der Geschichte» abzuwerfen und Tempo aufzunehmen. Die Anhänger sollten sich bereitmachen für «Vollgasfussball» und für einen emotionalen Sturm auf den zwischenzeitlich viel zu ruhig gewordenen Rängen des Stadions an der Anfield Road.
Die Gegner werden weggefegt
Und der Sturm kam. In Anfield werden seit Monaten die Gegner reihenweise weggefegt – und nun auch die letzten Befürchtungen, dass den seit 1990 beharrlich in der Liga gescheiterten Verein doch noch irgendein sportliches Unglück ereilen könnte. «Wir werden Meister, jetzt glaubt ihr es uns», sangen die Fans erstmals vor vier Wochen, als man 2:0 gegen United gewann. Klopp, seit Monaten darum bemüht, keinen Übermut aufkommen zu lassen, liess sie gewähren. «Natürlich ist es ihnen erlaubt, zu träumen und zu singen, was immer sie wollen», sagte er. «Es wäre komisch, wenn sie zurzeit nicht in guter Stimmung wären. Alle sollten die Situation geniessen, alle bis auf uns. Wir können noch nicht Teil dieser Party sein.»
Die Arbeit ist noch nicht vorbei. Mit dieser bis zur Erschöpfung wiederholten Botschaft hält Klopp im Verein die Spannung hoch. Das nächste Spiel ist das Wichtigste. Diese Rhetorik hat sich an seinen früheren Stationen Mainz (Aufstieg in die Bundesliga) und Dortmund (zwei Meisterschaften und DFB-Pokal-Sieg) bewährt, seine Spieler kamen so auf dem Weg zum grossen Ziel nicht zum Nachdenken. Die absolute Fixierung auf den Moment ist eine der Kloppschen Schlüsselmaximen. «Wir denken nicht nur von Spiel zu Spiel, sondern auch von Training zu Training», sagt Assistenztrainer zwei Pep Lijnders, «Intensität ist unsere Identität.»
Die Medien würden aber lieber darüber reden, wie es sich für Klopp und Co. anfühlt, ähnlich wie ein Kind vor Weihnachten einem unausweichlichen Glück entgegenzufiebern. Keine Chance. Als der Trainer vor dem Spiel gegen Norwich gefragt wurde, welche Parallelen er zu dem erfolgreichen Titelrennen mit Dortmund in der Bundesliga ziehen könne, hatte er sofort einen schlagfertigen Satz parat. «Die Fragen der Reporter waren dort genauso dämlich», meinte der 52-Jährige lachend, und die Reporter lachten mit. Fast hat man den Eindruck, er würde vor allem gern und schnell Meister werden, damit man ihn mit diesen ewigen Fragereien in Frieden lässt. Es dauert nicht mehr lange. Auf dem Platz bleibt seine Elf keine Antworten aus.
Liverpools Konstanz sprengt alle Superlative. Im Januar 2019 verlor die Mannschaft zum letzten Mal ein Spiel in der heimischen Liga (1:2 bei Manchester City). In der laufenden Spielzeit gewannen die Roten bis auf ein 1:1 gegen Manchester United im Oktober jedes der bisher 26 Saisonspiele. Falls der Gewinn des Titels in wenigen Wochen nicht noch zu einem verständlichen Druckabfall führt, kann Klopps Elf das Kunststück von Arsène Wengers Arsenal (2003/04) wiederholen, ungeschlagen durch die Spielzeit gehen – und zudem weit mehr als jene 100 Punkte erreichen, die Pep Guardiola mit City 2018 erzielte.
Damals hätte niemand für möglich gehalten, dass eine englische Mannschaft diesen historischen Rekord in naher Zukunft brechen könnte. Nicht gegen Guardiolas City, das von der Herrscherfamilie aus Abu Dhabi alimentierte Kombinationskollektiv. Nicht in der Premier League, wo die Dichte an Spitzenmannschaften höher ist als anderswo und selbst Abstiegskandidaten wie Norwich über hervorragende Einzelkönner verfügen.
Dass sich Liverpool in eine nahezu unheimliche Ergebnismaschine verwandeln würde, wie es sie bei den Scousers selbst in den goldenen Siebzigern und Achtzigern nie gab, war dabei angesichts der kapriziösen Anfangsjahre unter Klopp schwer vorstellbar. Seine Mannschaft entfachte mit ihrer wilden Hatz nach dem Ball zwar jedes Mal ein grosses Chaos in der gegnerischen Hälfte, vermochte den Wahnsinn in Ermangelung einer defensiven Absicherung jedoch selbst kaum zu kontrollieren.
Vorne wie hinten konnte alles Mögliche passieren, und das tat es dann auch regelmässig. Ein 5:4-Sieg über Norwich im Januar 2016 stand typisch für die ungezügelte, gänzlich unaustarierte Wucht der Truppe. Im Überschwang um den Last-Minute-Siegtreffer von Adam Lallana hatte Klopp so heftig mit seinen Schützlingen gefeiert, dass seine Sehhilfe in die Brüche ging.
Klopp schreit nur noch selten
Am Samstag musste man sich dagegen zu keinem Zeitpunkt Sorgen um sein Brillengestell machen. Klopp stand wie bei so vielen Partien in dieser Saison meist recht ruhig an der Seitenlinie. Er hat es nicht mehr nötig, Zuschauer und Spieler zum Brennen zu bringen. Dafür funktioniert das Grosse und Ganze längst zu gut. Seine Gelassenheit, erklärt Assistenztrainer Peter Krawietz, sei gleichermassen Ergebnis und Ursache von Liverpools Wandlung zu Dauersiegern. «Wir wissen, dass wir jederzeit zuschlagen können, dass es am Ende zielführend und erfolgreich sein wird. Man muss diese Erkenntnis (als Trainer) auch ausstrahlen.»
Seit geraumer Zeit wird er, wenn überhaupt, nur noch wegen bestimmter Aktionen laut. Wegen eines falschen Laufwegs etwa, wegen eines schlecht getimten Anlaufens – oder um Lob auf den Rasen zu schreien. «Viele glauben, Klopp spiele an der Seitenlinie Theater, wenn sie ihn dort herumlaufen sehen», sagt der niederländische Mittelfeldspieler Gini Wijnaldum, der so gut wie jeder LFC-Akteur unter Klopp ein völlig neues Leistungsniveau erreicht hat. «Aber genau so ist er. Er ist wirklich glücklich, wenn diese kleinen Dinge klappen. Die Grätschen. Oder wenn ein Spieler hingeht, aushilft, einen Schuss abblockt. Er sorgt dafür, dass du das auch mitbekommst. Das sind die Momente, die ich am meisten geniesse.»
Wer das Geheimnis einer Elf ergründen will, die weit über die Qualität ihrer Einzelspieler hinaus Fussball spielt, muss exakt hier anfangen: bei den Details. Klopp gilt ob seines gewaltigen Charismas zwar zu Recht als Menschenfänger. Doch seinem Erfolg liegt weder gottgegebenes Talent noch Zauberei zugrunde, sondern systematische, mit handwerklichem Ernst versehene Arbeit an allen erdenklichen Stellschrauben. Sein Liverpool ist ein Gesamtkunstwerk aus Fleiss und Lernfähigkeit. «Wir sagen den Spielern ständig, kleine Dinge sorgten dafür, dass Grosses passiert», fasst Lijnders den Leitgedanken zusammen. Zu diesen kleinen Dingen gehört zum Beispiel, dass sich Klopp kurz nach seiner Ankunft die Namen der achtzig Mitarbeiter im Trainingszentrum Melwood einprägte, sie in den Speisesaal bat und den Spielern einzeln vorstellte. Mannschaft und Personal hätten die Pflicht, einander zu helfen, betonte er, Liverpool müsse «ein Team und eine Familie» sein.
Nachdem er das Publikum mit rasendem Achterbahn-Fussball aus der Lethargie gerissen und seine Trainingsmethoden den ungewohnten Bedingungen auf der Insel (viel Wind, wenige Spielunterbrechungen, keine Winterpause) angepasst hatte, verstärkte Klopp mit chirurgischer Präzision sein Kader. Ihm ist dabei entgegengekommen, dass Liverpool von sehr smarten amerikanischen Investoren geführt wird, die bereit waren, für den famosen Torhüter Alisson Becker (AS Rom) und den nicht minder famosen Innenverteidiger Virgil van Dijk (Southampton) in der Summe knapp 150 Millionen Pfund auf den Tisch zu legen.
Ein Grossteil dieser Summe wurde allerdings durch den Verkauf des Brasilianers Philippe Coutinho gedeckt, der nicht ganz zufällig weder in Barcelona noch beim FC Bayern an seine famosen Leistungen im Liverpool-Trikot anschliessen konnte. Die Verpflichtung von Alisson und van Dijk, die der ebenfalls äusserst smarte LFC-Sportdirektor Michael Edwards empfohlen hatte, wirkte sich auch nur derart spektakulär auf die defensive Stabilität aus, weil Klopp vorübergehend zwei Low-Budget-Aussenverteidiger, Andy Robertson (zuvor bei einem Absteigerklub namens Hull City) und Trent Alexander-Arnold (eigene Jugend), zu absoluten Spitzenkräften entwickelt hatte.
Stars kamen zu günstigen Preisen
Wenn nun im Zuge der Liverpoolschen Total-Dominanz andere Trainer bei Klubs wie Manchester United oder Chelsea nach teuren Koryphäen verlangen, dürfen die Fans von Klopps Team überlegen lächeln. Keiner der drei Top-Scorer Roberto Firmino, Mohamed Salah und Sadio Mané kamen als Superstars an die Mersey, sondern für vergleichsweise kommode Preise von der TSG Hoffenheim, der Roma und Southampton. Sie wurden erst im Verbund mit den Mitspielern zu Raketenstürmern.
Bei keinem Profi lässt sich der Bessermachereffekt stärker ablesen als bei Kapitän Jordan Henderson. Der Mittelfeldspieler gehört zur Spezies braver Arbeiter, Trainerlegende Alex Ferguson verzichtete einst auf eine Verpflichtung, da er fand, der Mann aus Sunderland laufe merkwürdig unrund. Noch vor gut einem Jahr meckerten die Zuschauer in Anfield, wenn «Hendo» den Ball in der Zentrale oft lieber zurückspielte, ein unumstrittener Stammspieler war er nie. In Abwesenheit des lange verletzten Brasilianers Fabinho, den Klopp als «Leuchtturm» des Teams bezeichnete, fungierte der 29-Jährige auf der Sechser-Position in der laufenden Spielzeit jedoch derart solide, dass er mittlerweile als ernsthafter Kandidat für die Wahl zum Spieler des Jahres gehandelt wird. Seine Uneigennützigkeit, Bescheidenheit und persönlicher Fortschrittswille stehen sinnbildlich für die Wesenszüge der gesamten Mannschaft.
Bei der Siegerehrung nach dem Gewinn der Champions League in Madrid hatte Henderson angeregt, dass Kollege James Milner als dienstältester Spieler den Pokal mit in die Höhe hebt. «Für ihn kommt immer die Mannschaft zuerst», schrieb Milner in seiner Autobiografie, «das wird sich nicht ändern. Aber ich hoffe, dass er aufgrund des Erfolges merkt, was für ein brillanter Spieler er ist.»
Es geht immer noch ein Stückchen mehr. Klopp lebt seinen Schützlingen diesen Drang auf Optimierung tagtäglich vor. Er engagierte eine Ernährungsberaterin (Mona Nemmer, früher beim FC Bayern), einen Sportpsychologen und einen Spezial-Coach (Thomas Gronnemark) nur für Einwürfe, der mit dem Team feste Bewegungsmuster trainiert. Diverse Fernsehexperten lachten ihn dafür aus, aber Liverpool erarbeitete sich durch Gronnemarks Input einen messbaren Vorteil.
Sein Team bleibt nach Einwürfen deutlich öfter im Ballbesitz als Mannschaften, die auf den Zufall vertrauen. Für Spitzenklubs ungewöhnlich ist auch der Fokus auf Standardsituationen. Interne Analysen hatten ergeben, dass Liverpool zu wenig aus den ruhenden Bällen machte. Der Trainerstab entwickelte zahlreiche neue Ideen und perfektionierte synchrone Abläufe, 2019/20 sind die Reds in dieser Disziplin nun ebenfalls spitze. «Wir wollen, dass unsere Standards entscheidend sind», sagt Lijnders. «Normalerweise legen nur Mannschaften mit Problemen aus dem Spiel heraus diese Mentalität an den Tag.»
Liverpool kann aber auch spielen. Die Umschalttaktik aus den ersten Jahren ist zwangsläufig einem ganzheitlicheren Ansatz gewichen, da sich viele Mannschaften tief in der eigenen Hälfte verschanzen und keinen Raum für Konter bieten. Klopp hat mithilfe seiner Mitarbeiter ein ausgeklügeltes Ballbesitzspiel entwickelt, das es dennoch schafft, Tempo in die Angriffszüge zu entwickeln. Ein Analystenteam aus Astrophysikern und Datenwissenschaftern, das auch einen promovierten Philosophen umfasst, hat eine Formel entwickelt, die zeigt, wie stark die Chancen auf einen Torerfolg mit der räumlichen Aufteilung der Mannschaft einhergehen. Klopp kann diese komplexen Zusammenhänge vermitteln, und sein Mittelfeld um Henderson kann die Anweisungen mit viel Hingabe und Engagement umsetzen, auch wenn von dieser Arbeit wenig offensichtlich wird.
Die Bildhauer können anrücken
Durch diese unzähligen Mikroverfeinerungen – zu denen übrigens auch die Verlegung eines extra schnellen Rasens an der Anfield Road gehört – ist Liverpool nach vier Jahren Anlauf an einen Punkt gekommen, an dem sich absolutes Selbstvertrauen und Leistungsfähigkeit gegenseitig ununterbrochen verstärken. Klopps «Mentalitätsmonster» spielen einfach so lange ihr Spiel, bis sie gewinnen.
Zudem hatten sie in den richtigen Momenten auch die notwendige Fortüne. Gemessen an der statistischen Qualität der gegnerischen Torchancen hätten sie zum Beispiel mehr Treffer kassieren müssen, aber die Stürmer schossen aus besten Lagen einfach daneben. Vielleicht greift bei der Konkurrenz mittlerweile die Angst, es mit einer monatelang ungeschlagenen Elf aufnehmen zu müssen. «Wenn du immer wieder in den Schlussminuten Tore machst, ist das kein Glück», sagte Guardiola neulich anerkennend über den furchteinflössenden Siegeszug der Reds. «Liverpool hat unglaubliche Qualität und die unglaubliche Fähigkeit, bis zum Ende zu kämpfen.»
Bis zum Ende zu kämpfen, wird in der Liga – allen Warnungen von Klopp zum Trotz – nicht nötig sein. Die Aufnahme des Deutschen in den Liverpooler Trainerolymp, neben den früheren Heilsbringern Bill Shankly und Bob Paisley, lässt sich kaum mehr abwenden. «Wenn Klopp Meister wird, stellen sie ihm hier Statuen auf», prophezeite der Ex-LFC-Verteidiger Jamie Carragher 2017 ohne jede Übertreibung. Die Bildhauer können bald anrücken.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Danke, cooler Bericht!
Ich bin halt ein wenig hin und hergerissen: einerseits absolut geil, dass das ewige Titellose und „Ende Saison meist im Mittelfeld endende“ Zeit durch diese wahrsch nicht zu topende Hammersaison definitiv zu Ende geht! Andererseits frage ich mich, wie lange dies aufrecht erhalten werden und wieviel Perfektion verträgt der Fussball noch?
Wie korrekt geschrieben wurde, hat Klopp an allen erdenklichen Details gefeilt und die Teile so zusammengefügt, dass das aktuelle Ergebnis daraus entstanden ist.
Auch wenn vieles davon kopiert werden kann und wird, so braucht es trotzdem den Menschen in der Mitte, der mit seiner Art alles zusammenhält und jeden mitreisst! Da spielt er schon in einer eigenen Liga, weil es wenige Fussballtrainer gibt, die das über mehrere Jahre durchziehen können, ohne dass er ungläubig wird.
Was mir daran nicht soo gefällt, ist der Punkt, dass die sogenannten Strassenfussballer, die Instinkt-Spieler, je länger je mehr auf der Strecke bleiben; Gerade weil halt eben alles bis ins kleinste Detail durchgeplant wird!
Es geht mir hier ein wenig so, wie bei der Globalisierung: geht es wirklich unendlich in diese Richtung weiter und macht es auch dann weiterhin Spass, wenn die Abwechslung immer mehr auf der Strecke bleibt?
Wenigstens hat es noch paar Kreativspieler dabei, die mit ihrer Unberechenbarkeit oft den Unterschied ausmachen und gerade deshalb macht es sehr viel Spass diesem Team zuzuschauen und sich mit der Region auf das Ende der viel zu langen Durststrecke zu freuen!!!
Die Situation erinnert mich irgendwie auch an unseren 1. April vor 20 Jahren...
...und was danach kommt, interessiert wohl momentan nur ganz wenige, was auch absolut verständlich ist, schliesslich soll man es jetzt geniessen!
Liverpool verlürt s‘1. mal die Saison, hüt hät wohl niemer demit grächnet + grad no 3-0...
Ich sehe schon Sanggalle als Meister! Olé!
Ich sehe schon Sanggalle als Meister! Olé!
Am Dienstag tagen die 55 Mitglieder-Verbände der Uefa. Gemäss gut informierten Quellen wollen sie jene Mannschaften zu Meistern küren, die aktuell Leader sind.
https://www.tagblatt.ch/sport/fcstgall…bKFdlQrW6vm8byE
![]()
denke, man hat wie geschrieben nur die 2 Möglichkeiten:
- alles bisherige streichen und in der nächsten Saison quasi von Vorne beginnen
oder
- das bisherige so werten, wie der aktuelle Stand ist
die 1. Version heisst: das bisherige wurde vergebens gespielt
die 2. Version: das aktuelle wird zwar berücksichtigt, aber was macht man mit den Barrageteilnehmern? (sofern nicht direkt auf-/abgestiegen wird)
länger als 1. Juli geht wegen den aktuellen Vertragslaufzeiten nicht, deshalb wird es sowieso Verlierer geben, egal wie entschieden wird...
wenn nun 2-n Wochen weder trainiert, noch gespielt werden kann, bräuchte es auch ein wenig Zeit bis man nei starten kann. deshalb würde ich auf Abbruch tendieren, mit dem aktuellen Stand.
Das ist aber schon gewaltig unfair, da ja nicht alle Teams die gleichen Gegner gehabt haben.
Im Fussball ist man halt verglichen mit anderen Sportarten in einem grösseren Dilemma, vor allem was die internationalen Wettbewerbe anbelangt... Im Eishockey ist eine CL-Teilnahme eher eine "Nice-to-Have" Geschichte mit aktuell wenig Prestige. Für einige Clubs wohl sogar eher mit finanziellen Verlusten verbunden, zudem mit möglichem Substanzverlust in der Mannschaft wegen zusätzlichen Spielen. Im Fussball ist eine Teilnahme am europäischen Wettbewerb eine Gelddruckmaschine und für viele Clubs auch das Zünglein an der Waage für die Kaderplanung. Ist man nicht dabei, verliert man u.U. Spieler bzw. kann einen Wunschspieler nicht holen. Insofern ist es schon verständlich, dass man irgendwie versucht hier europaweit zu synchronisieren.
Klar.
Aber was, wenn du in der BuLi auf Rang 5 bist und gegen die ersten drei schon gespielt hast und der vierte noch nicht?
Keine Titel, kein Auf- und Abstieg wie im Hockey wäre wohl die einzige faire Lösung.
Finde ich auch. Aber wie schon gesagt, geht's im Fussball weniger um Platz 1 oder 2, sondern um die CL-Plätze.
Kein Aufsteiger ist aber auch ziemlich hart, wenn ein Team da auf sehr gutem Weg war und keine Playoffs gespielt worden wären.
Offenbar will die Uefa, dass die nationalen Meisterschaften gleichzeitig den Betrieb wieder aufnehmen, auch um parallel Champions- und Europa-League-Betrieb wieder hochfahren zu können. Ob und wann das passieren kann, hängt natürlich einzig von der Corona-Entwicklung ab.
Allerdings müssen die Meisterschaften bis 30. Juni beendet sein. Klappt das nicht, werden die Meisterschaften annulliert. Dieses Szenario wird immer wahrscheinlicher, da der Corona-Peak in gewissen Ländern – wie England – erst für Juni erwartet wird.
Klappt ganz sicher nicht! :roll:
Optimisten
(oder Realitäts-Verweigerer)
nzz am sunntig:
Zurück in die Zukunft
Für den Fussball, dem keine Krise etwas anhaben konnte, wird die Corona-Pandemie zur Zäsur. Im Sommer dürften die Transfersummen deutlich sinken. Von Sebastian Bräuer
Normalerweise betonen Firmenchefs in Krisenzeiten, solide aufgestellt zu sein. Sie vermeiden jedes Anzeichen von Panik. Sie verweisen darauf, vorgesorgt zu haben.
Deutschlands wichtigste Fussballmanager machen seit Tagen das Gegenteil. «Geisterspiele sind unsere einzige Überlebenschance», warnt Christian Seifert, der Chef der Deutschen Fussball-Liga. «Wir müssen die Saison beenden, sonst wird es finanziell für zu viele Vereine so dramatisch, dass sich Dinge im Fussball verändern werden, an die man jetzt nicht einmal denken mag», sagt Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund.
Die Coronavirus-Pandemie beschert dem Fussball eine plötzliche, heftige Zäsur. Jahrelang überstand der wichtigste Sport der Welt Wirtschaftskrisen unbeschadet. Unaufhaltsam ging das Wachstum weiter, immerfort gab es mehr Spiele und Turniere, höhere Einnahmen und Transfersummen, der Boom erstreckte sich über sämtliche Kontinente. Jetzt zeigt sich: Die Geldmaschine ist doch nicht unzerstörbar. Sobald einmal nicht gespielt werden kann, und sei es nur für wenige Wochen, beginnt das Kartenhaus zu wackeln.
Die Aussagen der deutschen Fussballmanager waren teilweise auch taktischer Natur: Es ging darum, Druck auf den europäischen Verband Uefa zu machen, die Europameisterschaften wie am Dienstag beschlossen von 2020 auf 2021 zu verschieben. So steigen die Chancen, im Sommer die nationalen Ligen beenden zu können, falls die Corona-Krise rechtzeitig enden sollte. Doch unabhängig davon sind die Warnungen vor Engpässen ernst zu nehmen. Stephan Herth, der beim internationalen Sportvermarkter Infront die Fussballsparte verantwortet, sagt: «Es wird Vereine geben, die existenzielle Probleme bekommen. Alles hängt davon ab, wie solide sie gewirtschaftet haben. Wie viel Eigenkapital haben sie gebildet? Wie hoch sind die Rücklagen? Wenn ein Management zu knapp geplant hat, wird es eng.»
Moment der Wahrheit
Während einer längst vergangenen Krise schrieb der amerikanische Investor und Multimilliardär Warren Buffett seinen Anlegern einmal: «Bei Ebbe findet man heraus, wer ohne Badehose schwimmt.» Viele Branchen haben diesen schmerzlichen Moment, in dem Schwächen gnadenlos offengelegt werden, erleben müssen. Als 2000 die Dotcom-Blase platzte, traf es Internetfirmen, denen ein nachhaltiges Geschäftsmodell fehlte. In der Finanzkrise 2008 wurde grossen Teilen des Finanzsektors der Glaube zum Verhängnis, dass manche Märkte immer weiter wachsen würden. Und jetzt, 2020, geraten gewisse Geschäftspraktiken des Fussballs in den Fokus.
Vorbildlich geführte KMU versuchen, in guten Zeiten für mehrmonatige Flauten vorzusorgen. Fussballvereine budgetieren knapper. Das weitverbreitete Credo lautet, jeden verfügbaren Euro für Spieler auszugeben, weil die Konkurrenz das Gleiche macht. Das Szenario eines wochenlangen Spielverbots in den Finanzplänen ignoriert zu haben, könnte sich jetzt bitter rächen.
Die Beratungsfirma KPMG hat Schätzungen aufgestellt, wie hoch die Verluste in den wichtigsten Ligen ausfallen würden, falls die Saison nicht beendet wird (siehe Grafik). Die Zahlen machen deutlich, warum viele Manager für Spiele ohne Zuschauer plädieren: Sie verdienen mit Fernsehrechten und Werbung deutlich mehr als mit Ticketverkäufen und Gastronomie. Je grösser der Klub, desto unwichtiger sind die Einkünfte am Spieltag.
Die drohenden Verluste sind zu relativieren. Der FC Barcelona und Real Madrid erwirtschaften pro Jahr beispielsweise jeweils Umsätze knapp unter der Milliardengrenze. Jetzt stehen in Spanien im Fall eines Saisonabbruchs 970 Millionen Euro auf dem Spiel, die von allen 20 La-Liga-Teilnehmern gemeinsam zu schultern wären. Hätten Fussballvereine ausreichende Puffer für Krisenzeiten, wäre das ohne grössere Verwerfungen möglich.
Der Druck, die Spielzeit irgendwie zu beenden, dürfte in den nächsten Wochen gross werden. Zumal zwischen Klubs und Fernsehsendern eine gegenseitige Abhängigkeit besteht. Henning Vöpel, der Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, sagt in Bezug auf Anbieter wie Sky und DAZN: «Fussball ist das Flaggschiff dieser Sender. Ohne Fussball hätten diese Sender wohl kaum eine Chance, wirtschaftlich zu überleben.»
Vertreter der Bundesliga beklagen sich besonders lautstark über die Situation, doch andere trifft die Krise noch härter. Infront-Manager Herth sagt: «Die Mannschaften der ersten beiden Ligen in Deutschland sind grundsätzlich auf einem guten Weg. In Italiens Serie A ist die Situation schlechter.» Vor allem im Amateurbereich bestehe zudem das Risiko, dass Sponsoren ausfallen, weil sie selbst wirtschaftliche Probleme bekommen.
Auch in der Schweiz ist die Situation angespannt. Die Super League nimmt mit Medienrechten nur 35 Millionen Franken pro Jahr ein. Ticketverkäufe sind für die Klubs relativ betrachtet wichtiger, Geisterspiele wären mit herben Einbussen verbunden. «Kleinere Ligen wie die Super League in der Schweiz trifft die Krise besonders hart, selbst bei solidem Management», sagt Herth. «Bei den dortigen Vereinen wird man nun sehr gut haushalten müssen, um eine Schieflage zu vermeiden. Einige werden in die Bredouille kommen.»
Die Schere geht auseinander
Der FC Thun stellte bereits ein Gesuch auf Kurzarbeit, der FC Sion spricht Spielern die Kündigung aus. An vielen Orten setzen Debatten über Gehaltsverzicht und Ausgleichszahlungen ein. Doch letztlich handelt es sich hier um Flickschustereien. Wie sehr sich der Fussball durch die Corona-Krise verändert, dürfte erst im Sommer zu beobachten sein.
«Es ist zu erwarten, dass die Transfersummen deutlich sinken», sagt Infront-Manager Herth. «Auch die Gehälter werden unter Druck kommen.» Das gelte nicht für die absoluten Topstars. Hier werde es weiterhin keinen Discount geben. Die Korrektur werde vor allem eine Stufe darunter, im mittleren Bereich der arrivierten Profis, zu beobachten sein. «Die Schere zwischen reichen und armen Klubs wird in dieser Krise noch weiter auseinander gehen», sagt Herth. «Das liegt unter anderem daran, dass kleinere Mannschaften schon bald zu Notverkäufen von Spielern gezwungen sein dürften, um finanzielle Schieflagen zu vermeiden. Ihnen bleibt keine andere Wahl, um im Budget zu bleiben.»
So unerfreulich das unmittelbar tönt, gerade aus Schweizer Sicht bleibt längerfristig eine Hoffnung. «Der Fussball kann gestärkt aus der Krise kommen», sagt Herth. «Man wird ein paar wichtige Lektionen gelernt haben, besser für schlechte Zeiten vorsorgen und Verträge sorgfältiger formulieren.» Auch im Silicon Valley und an der Wall Street war nach den Krisen 2000 und 2008 die Zeit der grössten Exzesse zunächst einmal vorbei. Herth sagt in Bezug auf den Fussball, der seinen «unvergleichlichen Wert» stets behalten werde: «Eine Korrektur ist gesund fürs System, das jahrelang nur gewachsen ist.»
die grafik kann ich nicht posten, hier die zahlen der vermuteten verluste, wenn nicht zu ende gespielt wird:
england: 1120 - 1280
spanien: 800 - 970
deutschland: 630 - 790
italien: 540 - 700
frankreich: 300 - 400
in millionen euro selbstverständlich...
die ticket ausfälle sind tatsächlich überall „nur“ +/- 10% der gesamtsumme. also noch knapp verkraftbar. darum denk ich schon, dass ab mitte mai die saisons mit geisterspielen zu ende gespielt werden. natürlich unter strengen auflagen. jeder im stadion anwesende hat den corona test gemacht etc.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Für den Fussball, dem keine Krise etwas anhaben konnte, wird die Corona-Pandemie zur Zäsur. Im Sommer dürften die Transfersummen deutlich sinken.
Vielleicht kommt man da wieder zum Idealbild von einigen Fans, welche jeweils ihre Transparente mit "Nein zum modernen Sport" im Stadion aufhängen...
Wie weiter in der Super League?
Die Zeit nach dem Shutdown verspricht viel Zündstoff
Auch in der Schweiz leiden viele Fussballclubs in der Corona-Krise. Aber Anfang Juni soll wieder gespielt werden.
Fabian Ruch (TA)
Letzte Woche ging der slowakische Traditionsverein MSK Zilina als erster Club in Europa wegen der Corona-Krise bankrott. Auch in der Schweiz geht die Angst vor dem Virus um. 19 von 20 Vereinen aus der Super und Challenge League haben Kurzarbeit für die Fussballer beantragt (nur Basel nicht), wobei offen ist, ob das Training zu Hause nicht als Arbeit gilt. Mehrere Vereine wie Thun haben zudem den Covid-19-Notfallkredit des Bundes über maximal eine halbe Million Franken in Anspruch genommen.
Und es gibt auch noch den Topf des Bundes mit 50 Millionen für Proficlubs. Dort allerdings sind die Hürden relativ hoch. Ein Betrieb muss nachweisen, alle notwendigen Massnahmen zur Schadensbegrenzung getroffen zu haben, er darf nicht mehr liquid sein und muss einen Abzahlungsplan vorlegen. Einige Clubs dürften in zwei Monaten an diesem Punkt stehen.
Die Swiss Football League hilft, wie sie kann, CEO Claudius Schäfer hinterlässt einen kompetenten Eindruck. Die fünfte von sechs Tranchen des TV-Vertrags hat die Liga einigen Vereinen als Vorbezug überwiesen, das macht bis zu einer Viertelmillion Franken aus, zudem könnte sie dank Rücklagen finanziell weitere Hilfe leisten.
Uneinigkeit bezüglich des neuen TV-Vertrags ab 2021
Die Diskussion über eine Modusänderung ist derweil aufgeschoben, zumal es keinen sinnvollen Spielplan für 12 Clubs gibt. Eigentlich hätte auch der TV-Vertrag, der 2021 ausläuft, neu verhandelt werden sollen. Schäfer möchte allerdings die Entwicklung in der Bundesliga abwarten, dort wurde die Ausschreibung kurzerhand verschoben. Er hat Signale mehrerer Player aus dem Ausland erhalten, die sich für die Rechte in der Schweiz interessieren könnten. Streamingdienste wie DAZN, aber auch Sky oder andere Anbieter sorgen im Idealfall für einen Bieterwettbewerb mit dem Platzhirsch Teleclub.
Längst gibt es Stimmen, die angesichts der komplizierten Umstände eine kurzfristige Lösung für bloss eine Saison statt eines neuen TV-Vierjahresvertrags bevorzugen. Vor allem der FCB drängt mit aller Macht darauf, erst alle Fragen betreffend Modus und Anspielzeiten auszudiskutieren, bevor sich die Liga langfristig an einen Partner bindet. Den Baslern ist dieser Punkt sehr wichtig, so scheint gar möglich, dass sie ihren Wünschen mit dem ultimativen Drohszenario Nachdruck verleihen: die Zentralvermarktung platzen zu lassen und ihre Spiele wieder selbst am Markt anzubieten. «Davon weiss ich nichts», sagt Schäfer. «Ich erlebe alle Vereinsvertreter als kooperativ und grösstenteils vernünftig.»
Es ist entscheidend, dass diese Saison zu Ende gespielt werden kann.
Claudius Schäfer, Liga-CEO
Unterdessen rüstet sich die Branche für die Zeit nach dem Shutdown. Das verrückteste Szenario haben die Engländer skizziert. Angeblich hat die Premier League Pläne für die Fortsetzung der Saison im WM-Format entworfen. Demnach sollen die 20 Teams im Juni und Juli in London sowie den Midlands in Hotels kaserniert werden – und die 92 restlichen Begegnungen als Geisterspiele auf Trainingsplätzen austragen. Premier League an jedem Tag als TV-Megaevent.
Es kursieren allerlei mögliche und unmögliche Szenarien. In Italien wollen einige Präsidenten so schnell wie möglich wieder spielen, obwohl noch täglich Hunderte Tote gezählt werden. In Spanien soll die Liga 50’000 Coronavirus-Testkits gekauft haben, um Profis täglich zu untersuchen. Auch in Deutschland wird die Bundesliga als Kulturgut betrachtet, Anfang Mai soll die Show weitergehen.
Und so werkelt jede Liga ein bisschen herum, wobei der europäische Fussballverband daran interessiert ist, das Vorgehen zu koordinieren. Letztlich geht es darum, die TV-Gelder zu retten. «Es ist entscheidend, dass diese Saison zu Ende gespielt werden kann», sagt auch Schäfer. Es sei viel einfacher, an der nächsten Spielzeit Veränderungen vorzunehmen bis hin zu einem Start erst im Januar 2021.
Vielleicht heisst es bald: Basel ohne XY (krank)
Die Uefa hat schon mal den Terminkalender freigeräumt für die Ligen. Die EM wurde um ein Jahr verschoben, Champions und Europa League sollen im Juli und August zu Ende gespielt werden, die Länderspiele im Juni fallen aus, Rahmenplan und Transfermarkt werden angepasst. «Es ist schön, zu sehen, wie die meisten Verbände und Vereine Hand in Hand arbeiten», sagt Wanja Greuel. Der YB-CEO sitzt nicht nur im SFV-Verbandsrat und im Ligakomitee, sondern mit Vertretern mehrerer Weltclubs auch im Vorstand der Europäischen Clubvereinigung ECA. Dort sind die 200 grössten Vereine versammelt, aus der Schweiz ist auch der FCB dabei. «Die Gespräche in der wöchentlichen Video-Vorstandssitzung sind zielorientiert», sagt Greuel. «Allen ist klar: Wir sitzen im gleichen Boot.»
Man könnte nach einer kurzen Pause vielleicht Mitte September mit der nächsten Saison beginnen.
Claudius Schäfer, Liga-CEO
Und wie geht es in der Schweiz weiter? «Es gibt viele Szenarien», sagt Schäfer. «Aber natürlich muss alles nach den Vorgaben des Bundes geschehen.» Es gibt Virologen, diese Hohepriester der Corona-Zeit, die davon sprechen, dass Fussballpartien erst 2021 wieder realistisch seien. Mit Zuschauern ohnehin, aber auch als Geisterspiele, weil sich Fans vor dem Stadion oder in Bars versammeln könnten.
Längst wird aber darüber diskutiert, dass man Geisterspiele in ein paar Wochen medizinisch gesehen problemlos durchführen könnte, weil das alles junge, fitte Athleten seien, die regelmässig getestet werden sollen. Ist ein Fussballer am Coronavirus erkrankt, würde es im Telegramm einfach heissen: Basel ohne XY (krank) – wie bei einer Grippe.
In der Schweiz wäre es laut Schäfer und Greuel wünschenswert, ab Anfang Juni während acht, neun Wochen die ausstehenden 13 Spieltage sowie die drei Cuprunden zu bestreiten. «So könnte man nach einer kurzen Pause vielleicht Mitte September mit der nächsten Saison beginnen», sagt Schäfer.
Modell auf Pump: Vielen Clubs droht der Konkurs
Das klingt alles ein wenig nach dem Prinzip Hoffnung. Aber was bleibt den Verantwortlichen anderes übrig? Die Uefa appelliert an alle nationalen Verbände, ruhig und geduldig zu sein. Die belgische Pro League entschied diese Woche überraschend früh, die Saison abzubrechen, das stiess der Uefa sauer auf. Deren Präsident Aleksander Ceferin erklärte, Solidarität sei keine Einbahnstrasse. Die Uefa setzte flugs ein Schreiben zusammen mit der ECA und der europäischen Ligavereinigung auf, in dem erneut mit dem Ausschluss aus dem Europacup gedroht wurde, sollte eine Saison vorzeitig beendet werden.
Auch im Fussball geht es darum, wie lange ein Unternehmen überlebensfähig ist. Eine Studie in Deutschland kam zum Schluss, dass 13 von 36 Proficlubs der beiden höchsten Ligen ohne Spielbetrieb sogar schon bis Juni in Konkurs gehen würden. Auch in Italien und Spanien stehen viele Wirtschaftsmodelle auf wackligem Fundament, zahlreiche Vereine haben künftige TV-Einnahmen längst verpfändet, das hochgezüchtete Geschäft ist oft auf Pump ausgerichtet. Kurzfristig mag ein Umdenken stattfinden, aber der Stresstest für die neu ausgerufene Solidarität und Vernunft kommt, sobald der Ball wieder rollt.
Und sowieso: Weil ein Impfstoff frühestens Anfang 2021 vorhanden sein dürfte, kann die Entwicklung des Virus in diesem Jahr jederzeit alle noch so schönen Pläne vernichten
Finde vor allem krass, wie das Thema in Deutschland diskutiert wird. Andernorts evt. auch, aber dort bekomme ich es am ehesten mit.
Die Proficlubs stellen sich dar, wie wenn sie das Wichtigste im ganzen Land wären.
Man könnte meinen, sie würden Deutschland retten, wenn sie wieder spielen könnten und man täglich 36 x 23 (ode rmehr) Corona-Tests für ihre überbezahlten Mitarbeiter ver(sch)wendet.
Natürlich geht es ums Überlegen, aber das geht es bei vielen Betrieben in dieser Zeit und in vielen diese Betriebe verdient nicht ein kleiner Teil der Firma ein Mehrfaches als alle anderen zusammen und man ist verzückt, wenn diese Mitarbeiter für einen Teil der Saison auf 20% des total überrissenen Lohnes verzichten. Die Spieler könnten alle auf ihr komplettes Gehalt für März - Juni verzichten und keiner von ihnen müsste Hunger leiden. Dafür hätten Sie in Zukunft vielleicht weiterhin die Strukturen zu Verfügung, die ihnen jetzt ein Leben in Saus und Braus ermöglichen.
Vielleicht wird das halt aber nicht mehr der Fall sein und ich glaube, auch ein rechter Anteil angefressener Fussballfans hätte nicht unbedingt Mitleid, wenn diese Blase platzen würde und wir in Zukunft ein anderes Fusballbusiness erleben würden.
überbezahlten Mitarbeiter
Jep! ![]()
auch ein rechter Anteil angefressener Fussballfans hätte nicht unbedingt Mitleid, wenn diese Blase platzen würde und wir in Zukunft ein anderes Fusballbusiness erleben würden.
Ich sehe eher das genau die Fans, die jeden Samstag ihrem Team nachreisen sich extrem freuen wenn ihr Club wieder einen total überbezahlten Tubel verpflichtet der einem anderen Club abgejagt wurde. Dort wird der gleiche Typ dann als Verräter, etc. gebrandmarkt und gehasst.
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!