![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Immer und immer wieder geil, sich dra z'erinnere.
Cha mal öper en entsprächende Smilie kreiere ? Und für de CHL Sieg grad au . . . ![]()
Nostalgie-Thread
-
-
herrliche bricht, haha
-
Tja, früehner isch alles besser gsi.

-
- Offizieller Beitrag
Zitat von torrenteherrliche bricht, haha
Isch damals rächt "kontrovers" bi vielne disskutiert worde. Wänn mer nöd wüsst, dass er's würkli
ernscht gmeint het müesst mer ganz klar säge: geili ironie! Nei, neiiii - da wird nöd graucht ......Und ja, was das alles betrifft bini würkli froh, dass ich das alles (ziemli passiv) miterläbt han - good old days!
Aber min 7-jährige Sohn hetti damals nöd ganz so gern mitgno wie das hüt de Fall isch. Hät also immer 2 Siite,
wie mer so schön seit. -
- Offizieller Beitrag
Mer wird nöd jünger...
-
haha, de bitsch. wer kännt en no?

-
- Offizieller Beitrag
Der «Club 21» wird 25
Erinnerungen an wilde ZSC-Zeiten
Jürg Vogel
Der «Club 21», die grösste Gönner-Zelle der ZSC Lions, feiert sein 25-jähriges Bestehen. In der Vergangenheit nahm er sich gewisse buchhalterische Freiheiten heraus.
Für den Gewinn der «Belle» gegen die Servettiens wählte keiner einen besseren Termin als der Architekt Ernst Meier: Der Präsident des «Club 21» feierte am Donnerstag sein 72. Wiegenfest. Die traditionsreiche Gönner-Zelle, in der pro Jahr 60 Einzel- und 90 Firmenmitglieder brutto über 1,3 Millionen Franken in den ZSC-Lions-Kreislauf pumpen, begeht in diesem Jahr selber ein Jubiläum. Seit einem Vierteljahrhundert existiert dieser «Club 21», der von Meier souverän präsidiert wird. Die Grande Fiesta, an der Mehrheitsaktionär Walter Frey den besten ZSC-Torwart aller Zeiten, Ari Sulander, mit einem Award für seine Karriere auszeichnen wird, steigt am 11. Juli.
Wenn die Stadtzürcher in der Gegenwart auf der obersten Plattform zum Powerplay ansetzen, dann haben die älteren Freunde des «Z» die wilden Zeiten in Oerlikon nicht vergessen. Im Bestreben, den Niederungen der NLB zu entrinnen, schüttelte mancher Sturm den ZSC durch. Im Hallenstadion zog Direktor Sepp Vögeli die Fäden. Der spätere Direktor der Tour de Suisse spielte im Eishockey manches Bully als Macher hinter den Kulissen. Vögeli war es, der den «Club 21» mitinitiierte.
Der Aargauer war berühmt für seine Marotte, Spielerverträge auf Papierservietten festzuhalten. Als der ZSC aus Arosa den Vorzeige-Verteidiger Reto Sturzenegger transferierte, flossen 40 000 Franken unter dem Tisch. Das Delikt ist heute längstens verjährt. Als der ZSC gegen die AHV-Zweigstelle aber einen Zweikampf verlor, mussten zehn Mitglieder aus dem «Club 21» für einen Bankkredit von einer Viertelmillion bürgen. Vögeli leitete deshalb für eine gewisse Zeit von den Matcheinnahmen 10 000 Franken um, bis der Kredit amortisiert war. Heute hat der ZSC den Ruf einer Nationalbank. Patron Frey beendete die Zeit der buchhalterischen Freiheiten. (NZZ)
-
Frage: Ja wievill kiffed dänn da ine?
Antwort: Jaaaaaa öppe jede 7beti oder 8ti.....ich schmeiss mich weg, zuuuu geil

-
HERRLICH

Das beste Derby aller Derbys
Einst trennten sie Welten, inzwischen haben sich die beiden Zürcher Finalisten angenähert.Tragen Sie mit Hinweisen zu diesem Artikel bei oder melden Sie uns Fehler.
Fünf Jahre nach Einführung des Playoffs in der Schweiz kam auch der ZSC im Saisonhöhepunkt der obersten Spielklasse an. Zuvor hatte er zweimal in den B-Playoffs den Aufstieg verpasst und war danach zwei weitere Winter in der Auf-/Abstiegsrunde engagiert. In der ersten Serie auf der grossen Bühne wartete 1991 ausgerechnet Kloten. Die beiden Clubs trennten damals Welten und nicht nur die drei Stationen auf der S-Bahn-Strecke 7 zwischen Oerlikon und Kloten.Der EHC Kloten galt als Eliteschule und produzierte im Schluefweg mehr Talente als jeder andere Schweizer Verein. Der Dorfclub aus der Agglomeration dominierte die sporadischen Zürcher Derbys über fast 30 Jahre meist mit erdrückender Überlegenheit. Der Liftclub ZSC ohne wirkliche sportliche Basis hatte dies mit Ohnmacht zu akzeptieren.
Die Antipathie gegen das sogenannte Eisballett richtete sich ab 1985 vor allem gegen den Klotener Captain und Überflieger Felix Hollenstein. Dieser nahm die Schmährufe im Hallenstadion als eine Art Ehrbezeugung auf. Der ZSC und sein Publikum zelebrierten mit Galgenhumor und Masochismus das Zittern und Leiden an den Schnittstellen der beiden Ligen. Bierduschen und Rauchschwaden gehörten zu einem ZSC-Abend, an dem Edi, der Trompeter, den Müden auf dem Eis das Zeichen zur Attacke blies.
Die Viertelfinals 1991 wurden zu einem selten gesehenen Spektakel – Freistil-Eishockey ohne Grenzen, dirigiert von den beiden Prager Pavels an der Bande Wohl und Volek. In den vier Spielen der Best-of-5-Serie fielen 42 Tore. Das 0:7 bei der Premiere konterte der ZSC mit einem 6:4 daheim. Wohl gab dabei erstmals dem einstigen Weltstar Wladimir Krutow Auslauf, der in den beiden Monaten seit seiner Ankunft aus Kanada nur im Block der Ersatzspieler trainiert hatte und vor allem mit Eskapaden abseits des Eises aufgefallen war.
Der kurzatmige «Tank» nutzte die Chance, schoss zwei Tore und gab einen Assist. Hallenstadion-Direktor Sepp Voegeli, der trotz aller Rückschläge an den ZSC und an Krutow geglaubt hatte, erlitt beim ersten erfolgreichen Abschluss einen Schwächeanfall bei seinem Standort neben der kleinen Medientribüne. Er pflegte von dort den Lauf der Spiele mit seinen typischen Anmerkungen zu kommentieren: «Chöndsitänke», «Chunntschoguet» oder «Wassägedsiejetzt?».
Das Aus für Bierdeckelverträge
Kloten mit den beiden schwedischen Stars Anders Eldebrink und Kent Nilsson gewann die Serie nach einem 9:3 im zweiten Heimspiel trotzdem. Im vierten Match glich Nilsson 21 Sekunden vor der Verlängerung zum 6:6 aus. Das Penaltyschiessen entschied dann Eldebrink als letzter Schütze, während beim ZSC Bob Martin nur die Lattenunterkante traf. Es war wenig vor Mitternacht bei rund 30 Grad im Dunstkreis in einer massiv überfüllten Halle. Der ZSC war dank diesem besten und verrücktesten aller Derbys in der Liga angekommen – und bestätigte es eine Saison später mit dem Playoff-Sieg gegen das Grande Lugano.
Mit dem Zusammenschluss des ZSC und der GC-Eishockeysektion 1997 wurden die ZSC Lions mit Präsident Walter Frey zu einer wirtschaftlichen und sportlichen Macht. Nach der Renovation des Hallenstadions suchte und fand der Club auch neues Publikum. Die Löwen wurden zu einem Player, der sich im grossen Unterhaltungsangebot der Stadt behaupten musste. Der lange hemdsärmlig geführte Verein, in dem Verträge auch auf Bierdeckeln besiegelt wurden, ist heute ein Vorzeigeunternehmen.
Kloten verlor seine Vorherrschaft im Ausbildungsbereich nach der Entwicklung beim Rivalen, musste Spieler verkaufen, um einigermassen in der Lohnspirale mitzuhalten. Die nachfolgende Vorwärtsstrategie mündete 2012 in den Totalabsturz, bei dem der Konkurs nur dank einer Taskforce, die in wenigen Wochen acht Millionen zur Schuldentilgung sammelte und vom neuen Präsidenten Philippe Gaydoul abgewendet wurde. Das «Dorf» kämpfte und behielt sein Aushängeschild. Im Prinzip ist aber ein Spitzenclub 5,8 Kilometer vom Hallenstadion und den ZSC Lions entfernt ein Anachronismus.
Pittis’ heisser Seitenwechsel
Auf dem Eis sind die beiden Clubs auf Augenhöhe, was die Qualifikation für den Final beweist. Die Rivalität ist noch vorhanden, aber doch abgeflaut und punkto Stimmung auf den Rängen nicht mit den Berner oder Tessiner Derbys zu vergleichen, wo immer noch Stadt und Land und Reich und «Arm» aufeinandertreffen. Bei den Lions und den Flyers gehören Transfers zwischen den Clubs mittlerweile fast zum Alltag. Dass Spieler beider Mannschaften eine Wohnung teilen, ist keine Seltenheit.
Von den vier Derbyserien seit 1991 war nur eine hitzig und stand unter besonderer Aufmerksamkeit. Der kanadische Center Domenico Pittis erzwang im Winter 2008 bei Nacht und Nebel einen Wechsel ins Hallenstadion. Damit wurde er zur Persona non grata im Schluefweg, was ihn aber damals nicht hinderte, mit den Lions die Viertelfinals gegen Kloten und dann auch den Titel zu gewinnen.
-
- Offizieller Beitrag
-
- Offizieller Beitrag
http://www.watson.ch/Sport/articles…e-pulverisieren
Han en zwei mal dörfe live gseh, mit de Rangers im Garden und dänn no in Florida gäge d Panthers.


-
- Offizieller Beitrag
Hürlimann, mein Zürcher Bier aus dem alten Hallenstadion
 hüt suf ich nur no Wändli
hüt suf ich nur no Wändli 
Verschwundene Fabriken (4)
Eine Stange aufs Brauhaus
Hürlimann war der Inbegriff von bürgerlichem Unternehmertum. Aus der traditionellen Zürcher Brauerei ist die grösste Immobiliengesellschaft der Schweiz geworden: Die Entwicklung hat durchaus mit Bier zu tun.
Denise Marquard
Die Pferde der Brauerei Hürlimann waren bis Mitte der 90er-Jahre eine feste Grösse im Stadtbild. Alle kannten sie, jeder liebte sie. Logistisch gesehen waren sie schon lange ein Anachronismus, aber sie waren das perfekte Symbol für Lokalstolz und Braukunst. Über die Tiere wurden Geschichten erzählt. «Jedes Pferd hatte so seine Eigenheiten», erzählte Fuhrmann Hermann Bieri später. «Nero hat gerne Bier getrunken, Louis biss gerne Autoantennen ab. Und Moritz zeigte eine grosse Tramängstlichkeit.» 1995 wurden die Pferde in Pension geschickt.
Wenig später spielten sich rund um die Zürcher Traditionsbrauerei dramatische Szenen ab. Am 7. Juni 1996 trafen sich die Aktionäre zu einer ausserordentlichen Generalversammlung im Schützenhaus Albisgüetli. Es gab bloss ein Traktandum: die Fusion mit dem Erzrivalen Feldschlösschen.
Die Brauerei aus Rheinfelden war damals die unbestrittene Nummer eins auf dem Schweizer Biermarkt, Hürlimann die Nummer drei. Die Rechnung ging für den Zürcher Betrieb dennoch nicht mehr auf. Hürlimann-Verwaltungsratspräsident Walter Hefti bezeichnete das Zusammengehen als «zukunftsweisenden Schritt». Die Eigentümerfamilie war gespalten. Vor allem Martin Hürlimann, der letzte Spross der Bierdynastie, war noch Brauer mit Leib und Seele. Aber er war in der Minderheit. Als sich an der Generalversammlung eine Mehrheit für die Fusion abzeichnete, setzte er sich Kopfhörer auf und drückte die Playtaste seines Walkmans.
240 Hürlimänner unter Schock
Martin Hürlimann war nicht der einzige Verlierer. Nach der GV ging alles sehr schnell. Im Oktober wurde in einem dürren Communique mitgeteilt, dass infolge von Überkapazitäten der Standort Zürich geschlossen werde. 240 Hürlimänner verloren ihren Arbeitsplatz. Viele von ihnen waren langjährige Mitarbeiter, einige hatten ihr gesamtes Arbeitsleben auf dem Hürlimann-Areal in der Enge verbracht. Die Nachricht war ein Schock. In Zürich gab es damals 14 000 Arbeitslose, so viele wie seit Jahren nicht mehr. Einen Job zu finden, war schwierig, den verletzten Berufsstolz wiederherzustellen unmöglich.
Bierbrauen ist kein 08/15-Job. Es ist Tradition, Kunst und Kultur in einem. Bis in die 80er-Jahre war es zudem ein lukratives Geschäft. Die Bierbrauerei Hürlimann war auf Rosen gebettet, und Bierbrauer waren hoch angesehene Männer mit Standesbewusstsein. «Die Kantine war 1992 noch unterteilt in verschiedene Essensräume», schreibt Esther Hürlimann in ihrem Buch «Die letzten Hürlimänner»: «Einer für die Bierbrauer, einer für die Büroleute, einer für die Chauffeure und zum Schluss einer für den Rest.»
Perlen gehörten zum Betrieb
Dass sich die Konkurrenz auf dem Markt verschärfte und mit Bier allein nicht mehr das grosse Geld zu verdienen war, hatte sich schon in den 80er-Jahren abgezeichnet. Allzu tragisch nahmen die Hürlimänner das nicht. Das Unternehmen hatte schon etliche Auf und Ab erlebt. Zudem wusste man, wo der wahre Reichtum des Unternehmens inzwischen lag: in den Liegenschaften. Zum Immobilienportfolio zählten neben dem Brauereiareal Perlen wie die Gaststätten Du Pont, Du Nord, Gotthard am Tessinerplatz oder der Zeughauskeller.
Die Sicherheit war trügerisch. Auch bei Hürlimann war Shareholder-Value angesagt. 1989 war das Unternehmen aufgeteilt worden in die Brauerei und eine Immobiliengesellschaft. Quersubventionierung war zu einem schmutzigen Wort geworden, und die Bierbrauer konnten nicht mehr damit rechnen, dass ihre Verluste mit Gewinnen aus dem Geschäft mit den Liegenschaften kompensiert wurden. Eine neue Zeitrechnung hatte begonnen.
Die Brauerei Hürlimann galt zwar als zürcherisch wie die Zünfte. Die erste kleine Brauerei hatte jedoch Hans Heinrich Hürlimann (1803–1872) in Feldbach bei Rapperswil gebaut. Sein Sohn Albert Hürlimann-Müller (1828–1888) erlernte das Handwerk in Bayern und setzte auf Expansion. 1866 kaufte er für 70 000 Franken das Areal Zum steinernen Tisch in der Gemeinde Enge. Mit 20 Angestellten und einer für damalige Verhältnisse hochmodernen Brauerei begann das Zürcher Kapitel der Familie Hürlimann.
Es sollte eine Erfolgsstory werden. Als Albert Heinrich Hürlimann (1857– 1934), dritter Spross der Dynastie, Bertha Hirzel heiratete – eine Zürcherin aus der Seidenbranche –, beschloss man, auch standesgemäss zu residieren, und liess 1898 über der Brauerei eine schlossähnliche Villa bauen, den Sihlberg. «Königin Bertha» wurde bald zur festen Grösse in der feinen Zürcher Gesellschaft. Zusammen mit Albert Heinrich frönte sie ihren Hobbys, dem Reisen und dem Fotografieren. Die Gäste auf dem Sihlberg wurden nicht nur mit Speis und Trank, sondern auch mit Fotografien aus Ceylon oder Japan beglückt.
Albert Heinrich Hürlimann war ein Patriarch mit ausgeprägtem sozialem Verantwortungsbewusstsein. Lange bevor es Gesetz wurde, führte er eine betriebliche Krankenkasse für die Mitarbeiter ein. Er zahlte bessere Löhne als andere Unternehmen, und er förderte den Sparwillen und die Loyalität seiner Angestellten, indem er ihnen ermöglichte, ihr Erspartes zu guten Konditionen im Betrieb anzulegen.
Albert Heinrich war auch ein guter Unternehmer. Unter seiner Leitung ging es mit der Brauerei stürmisch aufwärts. Die Bierproduktion vergrösserte sich von jährlich 30 000 (1887) auf 250 000 Hektoliter (1928). Ohne neue Produktionsanlagen und mehr Angestellte war das nicht zu schaffen. Es wurde grosszügig in Sudhaus, Gär- und Lagerkeller investiert, die Stapelräume wurden erneuert. Besonders stolz war Hürlimann auf die erste Eismaschine in der Schweiz.
Teuer erkaufte Wirte-Loyalität
Zürich wuchs und entwickelte sich zur Industriestadt. Dadurch wurde der Markt grösser, aber auch der Wettbewerb härter. Die Brauerei Hürlimann musste die Konkurrenz in Schach halten. Das tat sie, indem sie die Wirte an sich band. Buffet, Ausschankarmaturen und Eis wurden gratis zur Verfügung gestellt. Um den Wirt «bei der Stange» zu halten, überreichte der Brauereivertreter Geschenke wie Kristallvasen, Meissner-Tischservices oder Taschenuhren.
Die sicherste Methode, den Bierabsatz zu sichern, bestand jedoch darin, die Beiz zu kaufen. Hürlimann übernahm die Liegenschaften der Restaurants. Als Hausherr konnte die Brauerei vorschreiben, welches Bier ausgeschenkt wurde. Eine andere Form bestand darin, Wirten Darlehen zu geben. Konnten Schuldner den Zins dafür nicht zurückzahlen und blieben sie auch die Bezahlung der Bierrechnungen schuldig, übernahm die Brauerei die Liegenschaft.
In den Zwischenkriegsjahren beschlossen die Bierbrauer, den mörderischen Konkurrenzkampf zu beenden. Sie schlossen untereinander Verträge ab, die einen Mindestverkaufspreis garantierten. 1934 wurde auch der Patriarch an der Hürlimann-Spitze abgelöst. Die vierte Generation rückte nach, und zwar gleich in Doppelbesetzung: Hans Hürlimann-Huber (1891–1974) hatte Chemie studiert, seine Liebe galt dem Bier und den Rohstoffen. Der charismatische Heinrich Hürlimann (1893–1963) war kaufmännischer Leiter der Brauerei.
Obwohl die Arbeitslosigkeit sehr hoch war, lief das Geschäft dank dem Kartellabkommen. Im Boom der Nachkriegszeit verdiente man erneut richtig viel Geld. Die ausländische Konkurrenz machte sich erst schwach bemerkbar. Hürlimann expandierte. Neue Absatzmärkte wurden gesichert, kleinere Mitbewerber übernommen und der Liegenschaftenbesitz ausgebaut. Der grösste Coup gelang 1984: Hürlimann übernahm Löwenbräu und war damit unbestrittener Platzhirsch in Zürich. Das Unternehmen forcierte den Ausbau des alkoholfreien Sortiments, zuerst mit Sinalco und dann mit dem eigenen Mineralwasser Aqui. All dies verschlang viel Geld.
Die Fusion war ein Flop
1989 trat der letzte Vertreter der Hürlimann-Dynastie zurück. Das Konkurrenzumfeld hatte sich stark verändert. Dank der Globalisierung fielen die Zollschranken, und auch die Zürcher tranken immer weniger Hürlimann und immer mehr ausländisches Bier. 1991 zerfiel das Schweizer Bierkartell.
Auch die Firmenkultur passte sich dem neuen Zeitalter an. Die alte Patronkultur wich dem Effizienz- und Renditedenken. Die Kluft zwischen Belegschaft und Management wurde immer grösser. «In den 80er-Jahren verlor die Familie im Zuge massiver Aktienkapitalerhöhungen und des Umbaus zu einem Konzern die Stimmenmehrheit und bald auch das Sagen auf operativer Ebene», schreibt Matthias Wiesmann in seinem Buch «Bier und wir».
«Bier braucht Heimat», hatte Martin Hürlimann stets gepredigt. Er sollte recht bekommen. Die Fusion mit Feldschlösschen war ein Flop. Im Jahr 2000 kaufte die dänische Carlsberg-Gruppe das Getränkegeschäft von Feldschlösschen auf. Übrig blieben die HürlimannImmobilien. Auch sie wurden von der Globalisierung erfasst, tauften sich zunächst in Real Estate Group um und fusionierten schliesslich mit der PSP Swiss Property, der heute grössten Immobiliengesellschaft der Schweiz. Das Löwenbräu-Areal ist für die PSP heute ein Prestigeobjekt, wie es früher die Brauereipferde für Hürlimann waren.
© Tages Anzeiger -
S'isch au hüt na guet - au wänns keis Züribier meh isch [emoji6][emoji482]
-
-
- Offizieller Beitrag
-
- Offizieller Beitrag
Läck, scho 6 (!) Jahr her!

Aber schööööön isch es gsi!



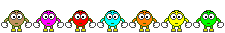


-
- Offizieller Beitrag
Ein Film für uns Oldies

-
- Offizieller Beitrag
Zitat von LarryEin Film für uns Oldies

Wow, liest sich sehr, sehr gut! Werde ich mir reinziehen - bin gespannt ob es die Erwartung erfüllen kann.
Thanks. -
Zitat von ZSColin
Wow, liest sich sehr, sehr gut! Werde ich mir reinziehen - bin gespannt ob es die Erwartung erfüllen kann.
Thanks.Ist definitiv sehenswert. Ich war am Dienstag im Kino. Interessante Einblicke ist Soviet-Hockey von damals und auch der eine oder andere Schmunzler war dabei.
Gerade auch als 'Semi-Oldie' der die USSR-Zeit nur noch am Rande mitbekam, sehr interessant. -
Ich war am Dienstag auch da und fand den Film sehr sehenswert!
Neben viel Schmunzeln auch ein paar nachdenkliche Sachen...
Und ein paar wirklich grossartige Szenen/Aussagen, wie z.Bsp. von Gretzky...
-
Jetzt mitmachen!
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!
